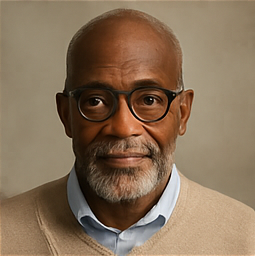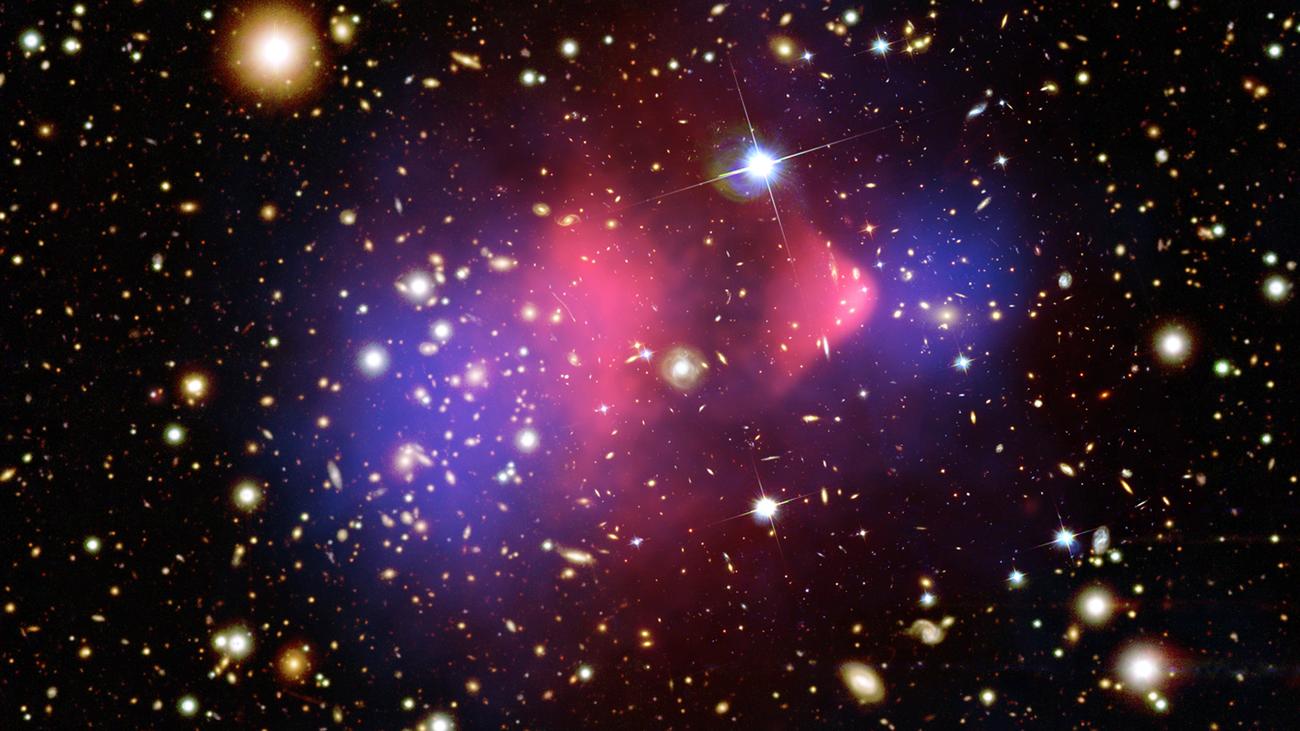Friedrich Merz: Entweder er bricht sein Wort – oder das AfD-Tabu

Oft genug macht der Absender den Unterschied: Wenn eines von über 360.000 CDU-Mitgliedern konstatierte, er habe "ein Problem" mit seiner Partei, würde das im Konrad-Adenauer-Haus sicherlich kein Achselzucken wert sein. Wenn nun aber nicht irgendwer öffentlich sein Parteibuch infrage stellt, sondern der Mann, der bis vor Kurzem noch die Grundwertekommission der CDU geleitet hat, mithin also zuständig war für das intellektuelle Kraftwerk der Volkspartei, dann ist das ein denkbar böses Omen. Und eines, das man ernst nehmen sollte. Die Rede ist von Andreas Rödder. Im Interview mit der Welt wirft der einen düsteren Blick auf seine politische Heimat. Und warnt vor einer Glaubwürdigkeitskrise nicht nur der Partei, sondern der demokratischen Institutionen insgesamt. Der Historiker Rödder ist damit nicht allein. Die Junge Union (JU), einst Bastion der Merz-Fans gegen das Parteiestablishment, nörgelt inzwischen lautstark. Johannes Winkel, ihr Bundesvorsitzender, drohte in der Bild, den Koalitionsvertrag in den bisher bekannten Parametern, also "massive Neuverschuldung" ohne "echte Strukturreformen", nicht zu unterstützen. In Mecklenburg-Vorpommern traten zuletzt zahlreiche Lokalpolitiker aus Enttäuschung über Merz aus der Partei aus. Und die Kölner JU hat gerade einen Wutbrief an ihre CDU verschickt, aus dem mehrere Medien zitieren: Sie fragten sich, wofür sie eigentlich gekämpft hätten, wenn sich die Partei dem "linken Mainstream" unterwerfe und sich "in Koalitionen rettet, um zu jedem Preis an die Macht zu kommen". Von einem "politischen Desaster" ist die Rede. Und es stimmt ja: Friedrich Merz war im Wahlkampf mit dem Versprechen eines Politikwechsels angetreten – um dann erst mal die Wahlversprechen der SPD einzulösen, Milliarden neuer Schulden. Rödder spricht gar von "Wählertäuschung". Keine Merz-Euphorie Man tritt ihm und den Mitstreitern seines R21-Thinktanks wohl nicht zu nahe, wenn man sie als die geistigen Wegbereiter der Merz-CDU versteht – in euphorischer Bejahung eines hoffentlich kantigeren Konservatismus und scharfer Abgrenzung zum intellektuellen Dämmerschlaf, der sich in den Merkel-Jahren über die Partei gelegt hatte. R21 steht, wie es in der Selbstzuschreibung heißt, für neue bürgerliche Politik. © Lea Dohle Newsletter Was jetzt? – Der tägliche Morgenüberblick Starten Sie mit unserem kurzen Nachrichten-Newsletter in den Tag. Erhalten Sie zudem freitags den US-Sonderletter "Was jetzt, America?" sowie das digitale Magazin ZEIT am Wochenende. Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Bitte geben Sie auf der folgenden Seite Ihr Passwort ein. Falls Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier . Und jetzt, kurz vor dem Ziel, dem Kanzleramt in der Hand eines echten Konservativen, bricht das große Hadern aus. Vom Unterstützer zum Kritiker, so schnell haben sich die Verhältnisse gerade bei vielen in der Union ins Gegenteil verkehrt. Euphorie jedenfalls sei gerade nirgends zu spüren, heißt es bei R21. Eher Fatalismus: Es deute sich mal wieder die alte Arbeitsteilung an, die Union bekomme das Kanzleramt, die SPD mache die Politik. Und auch die Ost-CDU scheint dem Verhandlungsgeschick ihres wohl künftigen Kanzlers nicht mehr recht zu trauen. Reiner Haseloff, der sich im Wahlkampf mit Bemerkungen vom Spielfeldrand auffällig lange zurückgehalten hatte, forderte im Angesicht einer immer stärker werdenden AfD nun den künftigen Koalitionspartner SPD auf, sich vor allem in der Migrationsfrage zu bewegen. Man kann das aber auch so verstehen: Über Umwege forderte Haseloff Merz auf, sich durchzusetzen. In Sachsen-Anhalt nämlich, seiner Heimat, wird nächstes Jahr gewählt. Sollte Merz nun keine Migrationswende hinkriegen, scheint der Machtverlust der CDU dort wie besiegelt. Nun gab es in der CDU zu jeder Zeit solche, die Merz verabscheuten für das, was er nun mal ist: ein Gewächs der Nullerjahre. Zu kalt, zu wenig Frau, zu viel Mann, zu neoliberal, zu westdeutsch, zu rechts. Damit kann und konnte der Parteichef die meiste Zeit gut leben. Im Osten galt er damit sogar mal als Hoffnungsträger. Die Kritik von rechts aber schmerzt, denn sie zielt ins Zentrum: Nun ist Merz plötzlich nicht mehr Merz genug. Merz' unmögliche Wahl: Wortbruch oder Tabubruch? Die Merz-CDU, findet Historiker Rödder, scheint bis jetzt noch keine Antwort darauf zu finden, wie sie rechte gesellschaftliche auch in politische Mehrheiten überführen will. Rödder hingegen hat eine Idee. Und das wurde ihm schon mal zum Verhängnis: Im September 2023 wagte er einen Vorstoß, die Union solle einfach eine Minderheitsregierung führen, was unweigerlich bedeuten würde, sie müsste sich für manche Entscheidungen Mehrheiten bei der AfD besorgen – es wäre das Ende der Brandmauer. Die Empörung schlug hoch, Rödder musste als Chef der Grundwertekommission zurücktreten. "Die Brandmauer ist der eiserne Käfig, in dem das links-grüne politische Lager die Union in babylonische Gefangenschaft genommen hat", bekräftigt Rödder in der Welt nun erneut ein Unbehagen, das viele in der Union teilen dürften. Ein unauflösbares Dilemma. Links ist abgewählt, "links ist vorbei", tönte die CDU noch im Wahlkampf, gleichzeitig braucht Merz linke Stimmen, um Kanzler zu werden. Rödder meint: Die Union braucht folglich Koalitionsalternativen von rechts, um nicht in eine ewige Geiselhaft der SPD zu geraten. Was den Kanzler in spe vor eine unmögliche Wahl stellt: Wortbruch – oder Tabubruch? Den eigenen Wahlkampf kassieren, kein Paradigmenwechsel bei Migration oder Steuern, keine grundsätzlich andere Klimapolitik, Vertrauensverlust und Frust inklusive. Oder er paktiert mit der AfD. (Die Antwort der Alt-Merkelianer, einfach vor der Wahl weniger zu versprechen heißt, hinterher weniger zu bereuen, kann man als dritte Option vernachlässigen.) Der Osten ist schon einen Schritt weiter Und wenn Rödders Einlassung vor allem eines deutlich macht, dann wohl das: Auch im dritten Jahr unter dem Vorsitzenden Merz scheint die Union noch immer kein funktionales Konzept gegen die AfD zu haben. Weiß man noch immer nicht, wie rechts man sein möchte und vor allem, wie viel davon die Gesellschaft braucht und was sie einen und nicht noch weiter spalten kann. Unterdessen steigen und steigen die Werte der AfD. In einer jüngsten Forsa-Umfrage nähert sie sich mit 24 Prozent der Union mit 25 Prozent beängstigend an. Auch bei Infratest liegt die Union nur noch zwei Punkte vor der AfD. Merz, der die rechtsaußen Partei einst halbieren wollte, droht nun, alsbald von den Rechtsradikalen überholt zu werden. Ein Horrorszenario. Nicht nur für die Union. Der Osten ist dabei, wie so oft, schon einen Schritt weiter. Auch deshalb wohl Haseloffs Intervention. Hier hat die von Rödder beklagte Konzeptlosigkeit längst neue politische Realitäten geschaffen und der Union ihre wohl düsterste Zukunft bereits vor Augen geführt: Bei der Bundestagswahl lag die AfD hier mit 32 Prozent erstmals weit vor der CDU (18,7 Prozent). Das also, was Haseloff selbst im Jahr 2021 und dem Sachsen Michael Kretschmer noch im Spätsommer 2024 bei den jeweiligen Landtagswahlen gelang, nämlich die AfD zu schlagen, scheint schon jetzt nur noch rosige Vergangenheit zu sein. Auch ist das, was Rödder beklagt und einfordert – nämlich weder eine Koalition noch eine Kooperation, sondern eine "konditionierte Gesprächsbereitschaft" gegenüber der AfD, wie er es nennt –, im Osten längst stille Praxis. Hier kann die Union, auf kommunaler Ebene ohnehin, längst nicht mehr schalten und walten, wie es ihr beliebt. Auch Kretschmer ist gezwungen, in einer sehr kleinen Minderheitsregierung mit der SPD zu regieren, Mario Voigt tut das in Thüringen in einer Pattregierung mit Sozialdemokraten und BSW. Sowohl in Dresden wie auch in Erfurt ist die Macht der AfD beinahe erdrückend, hier wie dort musste die Union bereits Kompromisse machen, die ihrer (westdeutschen) Reinheitslehre längst zuwiderlaufen. Also mit der AfD zaghaft beginnen, Mehrheiten zu beschließen, mit dem BSW zu regieren, mit den Linken zu reden. Und sie wird es wohl zukünftig noch viel öfter tun müssen. Die Union, das wurde zuletzt wieder deutlich, ist diskursiv in mindestens vier Welten auseinandergefallen: die grünstichige von Hendrik Wüst und Daniel Günther im Westen, die von Markus Söder und Manuel Hagel im Süden, die der Ost-CDU und Merz irgendwo dazwischen. Der versuchen muss, den Laden zusammenzuhalten und doch fürchten muss, jederzeit nach allen Richtungen nur Enttäuschungen zu säen. Schaut man nämlich in den Osten, kann man dort gut sehen, dass der Union eine partielle Unterstützung der AfD durchaus helfen kann, zum Beispiel bei der Absenkung der Grunderwerbssteuer wie in Thüringen, dass man sich aber bisher scheut, den Rechten bei den Themen näher zu kommen, die sie als ihre ureigensten beschreiben würden. Migration beispielsweise, Gendern oder Windkraft. Dementsprechend zurückhaltend hat man im Osten wohl auch auf die gemeinsame Abstimmung von Merz mit der AfD über die Migrationswende im Bundestag reagiert. Die Aktion hier in die Kategorie: Konzeptlosigkeit. Also genau das, was auch Rödder beklagt. Die Union im Osten muss letztlich beweisen, dass sie Probleme alleine und ohne die AfD lösen kann. Deshalb die Forderung von Haseloff, sich mit der SPD auf eine Migrationswende zu verständigen. Darüber hinaus drängen ostdeutsche Konservative, wenn man mit ihnen spricht, viel eher darauf, dass die Union sich wieder um die Themen kümmern soll, die eine strukturell weniger wohlhabende und zudem alternde Gesellschaft wie die ostdeutsche im Kern umtreiben: soziale Fragen wie Löhne, Pflege, Gesundheit, Bildung. 2018 kam die No-Groko-Bewegung von links. Ein zorniger Satz auf dem Parteitag markierte den kometenhaften Aufstieg des damaligen Jusochefs: "Wir, die wir hier in fünf, zehn, 20 Jahren Verantwortung übernehmen sollen, wollen und auch müssen, haben ein Interesse daran, dass auch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt noch mal", schleuderte Kevin Kühnert seiner SPD entgegen. 2025 könnte eine ähnliche Bewegung Merz von rechts erwischen, wenn er schlecht verhandelt. Vielleicht ist also die Zeit gekommen, dass sie in der Union die Jungsozialisten zitieren müssen. Und womöglich ist es nicht nur im Interesse der Union, dass von ihrem Laden noch was übrig bleibt. Fragt sich nur, wie das gehen soll.