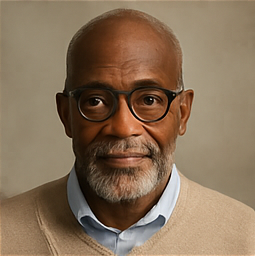Stadtspaziergang durchs Zeitungsviertel: „Ein paar Tage Berlin machen herrlich mobil“

Erich Kästner hatte es nicht weit vom Bahngleis bis zur Badewanne. Als er am Silvesterabend 1926 am Anhalter Bahnhof ankam, musste er nur durch den Tunnel gehen, der die Bahnhofshalle mit dem Hotel Excelsior verband, und schon konnte er sein Zimmer im 5. Stock beziehen. Dort „plantschte“ er erstmal, wie er dem „lieben Muttchen“ nach Dresden schrieb, und vergnügte sich dann bei Stadtbummel und Tanz. Nach einem Gespräch mit einem Redakteur von Ullstein – die Verlagsgebäude (siehe Foto oben) lagen nur wenige Gehminuten entfernt – reiste der junge Autor wieder ab. Wenige Monate später sollte er zurückkehren und bis 1933 als freier Mitarbeiter unter anderem für das „Berliner Tageblatt“, die „Vossische Zeitung“ und für die Zeitschrift „Weltbühne“ schreiben. Plantschte im Hotel Excelsior: Erich Kästner (hier ein Foto aus dem Jahr 1955). © picture-alliance/dpa/Georg Goebel Berlin ist das einzig Richtige. Jedenfalls der einzige Boden in Deutschland, wo was los ist. Erich Kästner „Berlin ist das einzig Richtige“, teilte er dem Muttchen mit. „Jedenfalls der einzige Boden in Deutschland, wo was los ist. Paar Tage da drüben machen einen herrlich mobil.“ Wo Kästner ankam, steht jetzt Michael Bienert, Autor und „Berlinologe“, am Ruinenportikus des einst größten Bahnhofs auf dem europäischen Festland. In der Hand ein Foto des ehemaligen Hotels Excelsior, im Rücken das gewaltige graue Hochhaus, das an dessen Stelle erbaut wurde, lange nachdem das Viertel im Zweiten Weltkrieg beinahe komplett zerbombt wurde. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können. Berlinologe Michael Bienert am Anhalter Bahnhof, mit einem Foto des ehemaligen Hotels Excelsior. © Dorothee Nolte Hier am Askanischen Platz ist seit 2009 auch der Tagesspiegel ansässig, der dieses Jahr 80-jähriges Jubiläum feiert: ein klassisches Nachkriegsprodukt. Vor dem Krieg jedoch waren es von hier aus nur wenige Schritte ins „Zeitungsviertel“, wo hunderte Verlage, Druckereien, grafische Betriebe tätig waren. Die drei Großverlage Ullstein, Mosse und Scherl produzierten hier ihre Massenblätter, das Viertel galt in der Kaiserzeit und der Weimarer Republik als der größte Presseplatz weltweit. Führungen durch das Zeitungsviertel Die nächsten Führungen von Michael Bienert durch das Zeitungsviertel finden am 11. Mai und am 18. Mai statt. Informationen auf der Webseite von Michael Bienert und auf der Seite des Romanischen Cafés. Dort sind auch die aktuellen Öffnungszeiten der Ausstellung im Europa-Center und andere Veranstaltungen im Ausstellungsraum zu finden. Bienert, Autor zahlreicher Berlin-Bücher, darunter „Kästners Berlin – Literarische Schauplätze“, beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Geschichte des Viertels. Er war auch an der faszinierenden virtuellen Rekonstruktion des Anhalter Bahnhofs beteiligt, die während der Corona-Zeit unter der Federführung des Technikmuseums erstellt wurde. Ins Capri zum Essen Regelmäßig führt Bienert zu den historisch interessanten Orten, mit einem Schwerpunkt auf den 1920er Jahren, als hier viele berühmte Autoren und Journalisten arbeiteten, von Kästner über Mascha Kaléko, Vicki Baum, Joseph Roth, Theodor Wolff bis zur Gerichtsreporterin Gabriele Tergit. „Tergit berichtet in ihren Erinnerungen, dass sie und ihre Kollegen vom Berliner Tageblatt immer ,ins Capri‘ zum Essen gegangen seien“, erzählt Bienert. „Das war hier in der Anhalter Straße.“ Mit „Roter Fahne“: Michael Bienert in einem Café im ehemaligen Zeitungsviertel. © Dorothee Nolte Schnellen Schrittes geht es die Stresemannstraße hinunter – „hier, in der damaligen Königgrätzer Straße, hatte zeitweise die Rote Fahne, das Zentralorgan des Spartakusbunds, ihren Sitz“ - und links in die Hedemannstraße. An der Ecke Hedemann-/Wilhelmstraße zeigt Bienert eine Postkarte: Genau dort wurde um 1930 an einer Hausecke groß für „Nazibedarf“ geworben. Ein indirekter Hinweis auf die Redaktion des „Angriff“, das Kampfblatt des NS-Gauleiters und späteren NS-Reichspropagandaministers Joseph Goebbels. Die im Krieg zerstörte Hausecke gehörte offensichtlich zu dem langgezogenen Gebäudekomplex, der bis zur südlichen Friedrichstraße reicht. „Hier hatten auch der ,Montagmorgen’ und das linke ,12-Uhr-Blatt’ ihren Sitz“, berichtet Bienert, „es war also ein Pressehaus mit politisch sehr gemischter Mieterschaft.“ „Politisch gemischte Mieterschaft“: Gebäudekomplex in der Hedemannstraße und taz-Neubau. © Dorothee Nolte Der taz-Neubau kommt in den Blick, von hier geht es scharf links die Friedrichstraße hoch bis zur Kochstraße, die einst das Zentrum des Zeitungsviertels darstellte. „Im Block Charlottenstraße/Kochstraße (heute Rudi-Dutschke-Straße) war der Ullstein Verlag angesiedelt, ein riesiger Komplex“, sagt Bienert. Doch davon ist rein gar nichts mehr zu sehen, ebenso wenig wie von der Jerusalem-Kirche, die an der Einmündung der heutigen Rudi-Dutschke-Straße stand und „Zeitungskirche“ genannt wurde; eine Infotafel mit Terrakottarelief und eine Doppelreihe von Pflastersteinen erinnern an sie. Auffallend dagegen der Springer-Altbau und Neubau in der Zimmer-/Ecke Jerusalemer Straße – auch dazu könnte Bienert viel erzählen, aber wir sind in den 1920er-Jahren unterwegs. Also endet die Tour da, wo ein eindrucksvolles Gebäude noch tatsächlich an das alte Zeitungsviertel erinnert: am Mosse-Haus. Hier wurde unter anderem das „Berliner Tageblatt“ redigiert und gedruckt: das Mosse-Zentrum. © Dorothee Nolte Das Haus, 1900-1903 erbaut, wurde bei den Spartakusaufständen 1919 schwer beschädigt: Michael Bienert hat Fotos dabei, auf denen sich Aufständische hinter riesigen Zeitungspapierrollen verschanzen. Der Architekt Erich Mendelsohn gestaltete das von den Kämpfen beschädigte Haus Anfang der 1920er-Jahre im Stil der Neuen Sachlichkeit um. Informativ: eine der Stelen, die die Initiative Historisches Zeitungsviertel aufstellen ließ. © Dorothee Nolte Eine Stele an der Ecke Schützen-/Jerusalemer Straße erklärt die Geschichte des Hauses: Sie ist Teil einer Ausstellung, die die – nicht mehr aktive – „Initiative Historisches Zeitungsviertel“ hier aufstellen ließ. Geplant waren einmal 14 Stelen, ein virtueller Rundgang mit vielen Informationen ist immer noch im Netz abrufbar. Viele bekannte Autoren, die im Zeitungsviertel ein- und ausgingen, waren auch regelmäßige Gäste im „Romanischen Café“ im vornehmen Westen Berlins, dort, wo heute das Europa-Center steht. Eine sehr hübsche kleine Ausstellung im Europa-Center erinnert seit Anfang 2024 an das Künstlercafé, Michael Bienert hat sie mitgestaltet und den Begleitband mit herausgegeben. So viel Lektüre: Zeitungswand in der Ausstellung zum Romanischen Café im Europa-Center. © Dorothee Nolte Eine Zeitungswand in der Ausstellung kündet von der Vielfalt der Publikationen in dieser Zeit, als ein Hauptvergnügen der Café-Besucher darin bestand, Zeitungen zu lesen. Gabriele Tergit als „geborene Berlinerin“ äußerte sich übrigens weniger enthusiastisch über Berlin als Kästner. Sie komme nicht gern am Anhalter Bahnhof an, schrieb sie. Denn: „Sofort empfängt einen wieder der raue Berliner Ton. In der Fremde lernst du dein besseres Selbst kennen. In Berlin wirst du wieder spitzzüngig, ernsthaft und erwachsen. Eingewöhnen in Berlin fällt mir schwer und fängt bei mir immer am Anhalter Bahnhof an.“ Dass viele der Journalisten und Autoren, die im Zeitungsviertel arbeiteten und im Romanischen Café Kaffee tranken, ab 1933 vom Anhalter Bahnhof aus ins Exil gehen mussten, ist wieder eine andere Geschichte.