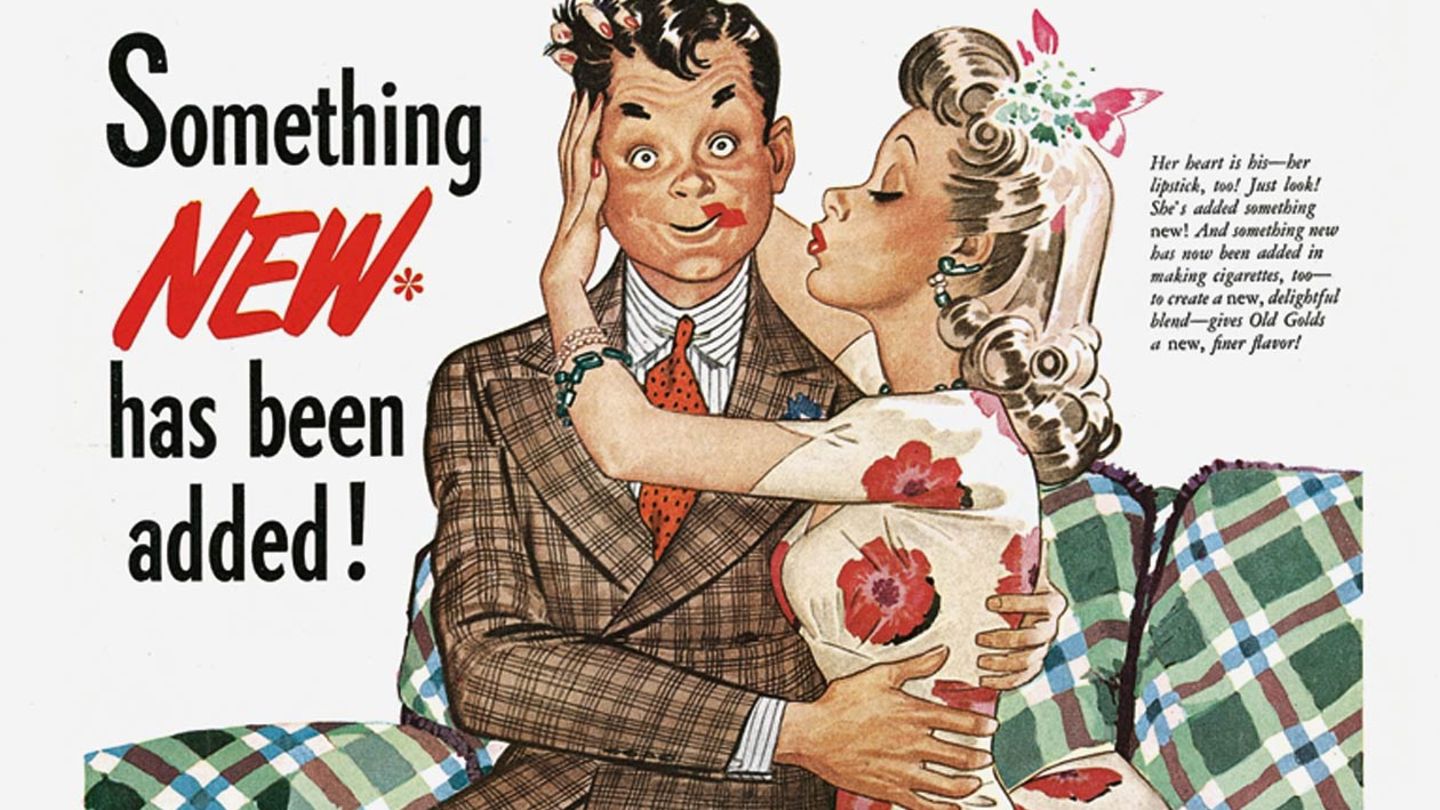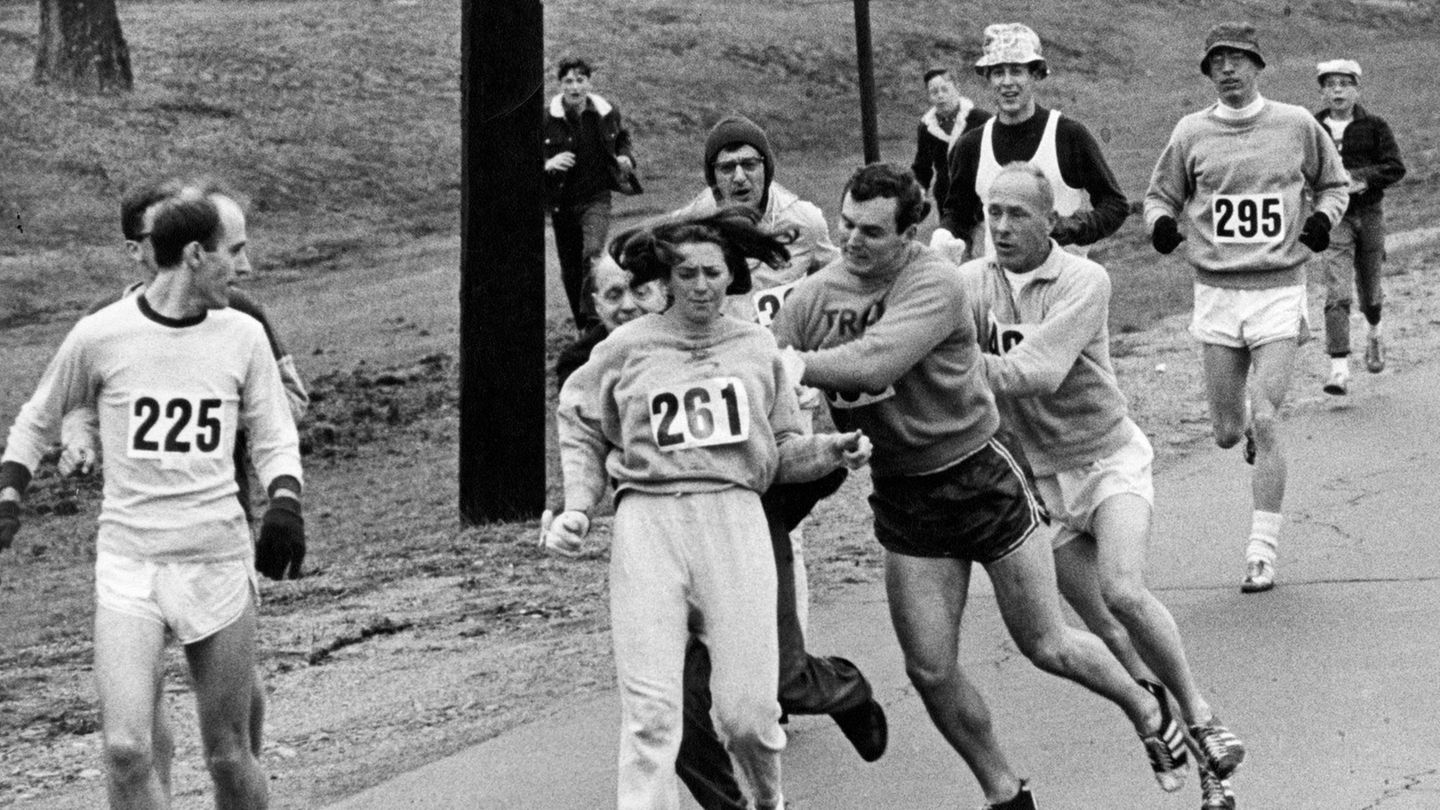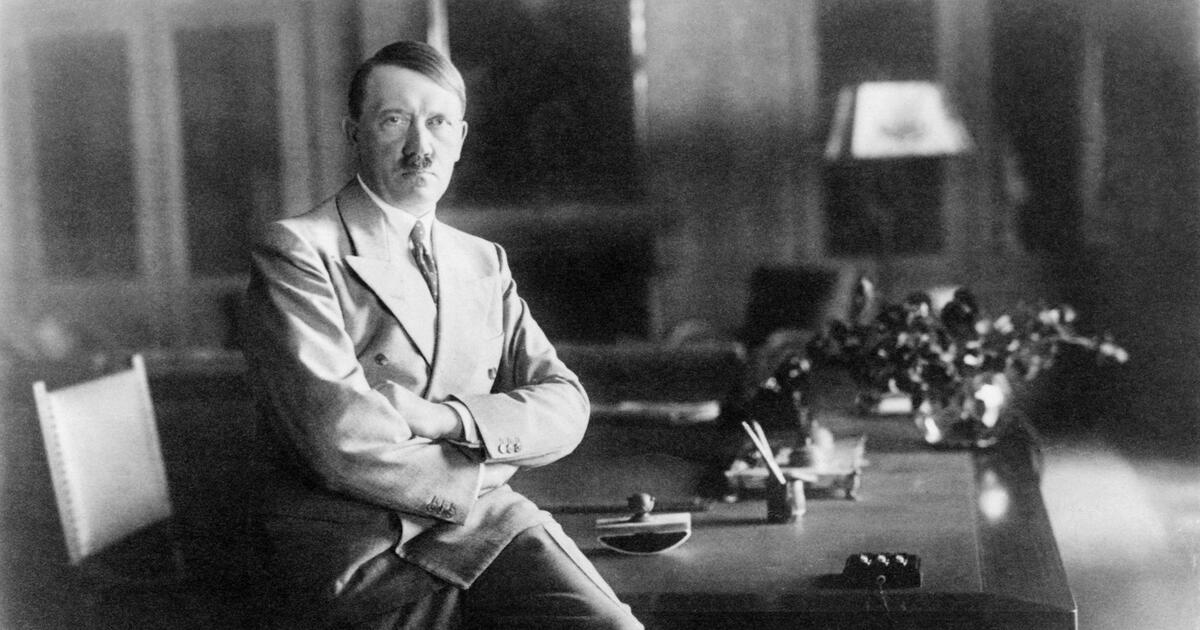Reden wir über Geld: „Ich habe ein paar Monate Hartz IV bekommen“

Dreimal hat Stephan Thome es geschafft, auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises zu gelangen. Das gelingt nicht vielen Autoren. Einem breiten Publikum wurde der 52-Jährige durch sein Debütwerk „Grenzgang“ bekannt, das später mit Lars Eidinger in der Hauptrolle verfilmt wurde. Thome sitzt in seinem Arbeitszimmer in Taipeh, als die SZ ihn per Videoanruf erreicht. Hier fängt er jeden Morgen an zu schreiben, mit einem Becher Darjeeling-Tee, den er aus England bestellt. SZ: Herr Thome, reden wir über Geld . Stephan Thome: Also von Geld verstehe ich gar nichts. Allein schon, bis ich es mal geschafft hatte, mein Sparkonto aufzulösen. Die Bank soll mir nur Dinge empfehlen, um die ich mich nicht weiter kümmern muss. Und wenn ich Geld anlegen will, gebe ich es meiner Schwiegermutter. Ist sie so gewieft in Geldfragen? Sie guckt jeden Tag Börsennachrichten und Talkshows. Sie spricht mit ihrer Bank und legt das Geld dann an. Ich sage ihr nur: Mach etwas mit meinem Geld, ich kann das nicht. Hat sie denn selbst so viel anzulegen? Im Gegenteil, sie hat nie regelmäßig gearbeitet und keine eigene Altersabsicherung. Sie muss mit ihrem Geld haushalten. Aber wenn sie es klug investiert, dann kann sie davon gut leben. Funktioniert es bei Ihnen gut, sich nicht für Geld zu interessieren? Das ist eine offene Frage. Man weiß ja nicht, wie sich dieser schwierige Literaturmarkt entwickelt. Ich lebe nicht ganz von der Hand in den Mund, kann immer zwei Jahre ungefähr überbrücken, aber dann muss halt wieder ein Buch da sein, und das muss sich einigermaßen verkaufen, oder der Verlag muss mir kurzzeitig unter die Arme greifen. Sie standen dreimal auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Das ist bislang kaum jemandem gelungen. Trotzdem scheint es kein Garant für wirtschaftlichen Erfolg zu sein. Also maximal ein Prozent der Autoren kann in halbwegs gesicherten Verhältnissen leben. Maximal! Insofern bin ich schon privilegiert, auch wenn es durchaus ein bisschen mehr Sicherheit sein könnte. Mehrere Jahre war ich nicht einmal ordentlich krankenversichert, sondern hatte nur eine Notfallabsicherung. Ich bin jetzt 52, da denkt man schon manchmal, dass die ein oder andere Vorsorgeuntersuchung auch nicht schlecht wäre. Gleich Ihr erster Roman „Grenzgang“ war ein Bestseller. Er spielt im hessischen Biedenkopf, Ihrer Heimat. Geschrieben habe ich ihn allerdings hier in Taipeh. Ich hatte an der Uni eine Stelle. Montags bis freitags war ich tagsüber gebunden, am Roman arbeiten konnte ich nur abends und am Wochenende. Ich habe mir so den Spitznamen „Mister Eleven o’clock“ eingehandelt, das klingt auf Chinesisch ganz ähnlich wie mein chinesischer Name. Mister Eleven o’clock? Weil ich freitags, wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, abends um 23 Uhr wieder weg war. Es war klar, wenn ich jetzt noch was trinke, dann kann ich morgen nicht mehr schreiben. War „Grenzgang“ Ihr erster Versuch? Nein, ich wollte schon in der Schulzeit Schriftsteller zu werden. Damals habe ich viel gelesen und dachte: Wow, das ist stark, das hat was mit meinem Leben zu tun. So entstand der abstrakte Traum, so etwas selbst zu verfassen. Aber meine frühen Versuche sind für meine Begriffe alle gescheitert. Als ich dann im Studium nach China gegangen bin, hatte ich schon den Gedanken, vielleicht muss ich mehr erleben, vielleicht bin ich viel zu behütet aufgewachsen in langweiligen Kleinstadtverhältnissen. Dass dann ausgerechnet mein erster veröffentlichter Roman in dieser Kleinstadt Biedenkopf spielt, ist ein bisschen ironisch. Der Schrecken jeden Autors ist die Absage für ein Manuskript, an dem lange gearbeitet wurde. Es ist hart, wenn nach zweieinhalb Jahren täglicher, mühsam abgesparter Arbeit eine Standardabsage kommt. Jede einzelne wäre ein guter Grund gewesen, es sein zu lassen. Aber dafür hat mir das Schreiben zu viel bedeutet. Weil ich diese Geschichten in mir habe, sodass ich irgendwann dachte, na gut, dann bist du halt dazu verdammt, ein erfolgloser Schriftsteller zu sein. Irgendwann sagte ein Agent zu mir: Du musst etwas schreiben, woran sie nicht vorbeikommen – worauf die offensichtliche Erwiderung war: „Die kommen an allem vorbei.“ Wie oft wurde „Grenzgang“ abgelehnt? Zehn bis zwölf Mal etwa. Auch daran kamen die Verlage vorbei. Bis Suhrkamp sich meldete, einer der renommiertesten Verlage Deutschlands. Ja, Suhrkamp, das war für mich der Verlag schlechthin. Das war ein Traum, der in Erfüllung ging. Das beglückt mich bis heute, dieses Gefühl geht wahrscheinlich nie weg. Dabei kam das Manuskript nur zufällig in die Hände von Suhrkamp. Sie hatten meinen Agenten aufgesucht, weil sie einen anderen Autor abwerben wollten. Geklappt hat es nicht, aber der Agent nutzte die Chance und sagte: „Ich hab’ hier noch was anderes, das solltet ihr euch mal angucken.“ Ihr Manuskript. Genau. Ich war gerade in Deutschland für eine Konferenz. Wegen des Jetlags war ich früh schlafen gegangen. Nach meiner inneren Uhr war es tiefste Nacht, als mein Vater reinkam und sagte: „Dein Agent hat angerufen, jemand will dein Buch rausbringen.“ Vielleicht hat er sogar Suhrkamp erwähnt. Ich antwortete, dass ich mich am Morgen darum kümmern wurde. Zwei Minuten später fiel mir ein, dass das auf keinen Fall bis zum Morgen warten kann. In der Nacht habe ich keine Minute geschlafen, habe mit einer Flasche Wein im Wohnzimmer gesessen und war von meinem Glück überwältigt. Warum war Suhrkamp so besonders für Sie? Es ist ein Verlag, der sagt: „Wir machen keine Bücher, wir machen Autoren.“ Als Autor hat man große Freiheit und einen unterstützenden Apparat. Sie machen sogar Bücher, von denen sie wissen, dass sie sich nicht besonders gut verkaufen. Zahlt Suhrkamp auch höhere Vorschüsse? Die zahlen eher weniger. In den 1990er-Jahren haben die Agenturen die Vorschüsse nach oben getrieben. Ein hoher Vorschuss wurde zu einem Statussymbol, aber das hat Suhrkamp so nie gemacht. Ich hatte nie ein Problem damit, weil ein sehr hoher Vorschuss auch eine Hypothek ist. Verlage, selbst wenn sie ein bisschen altruistisch sind, müssen rechnen. Wenn ein junger Autor oder eine Autorin für den ersten Roman 250 000 Euro Vorschuss bekommt und der Verlag am Ende 200 000 Verlust macht, dann sind die Autoren auch ein bisschen durch. Und wenn das Buch läuft, bekommt man ja sein Geld sowieso. Sie leben seit Jahren in Taiwan. Wie kam es dazu? In gewissem Sinne bin ich in Wirtschaftsmigrant. Ich war fertig mit der Promotion, habe aber in Deutschland keinen Job gefunden. Ich wollte im Bereich interkulturelle Philosophie weiterarbeiten, aber in den philosophischen Instituten war das zwischen Kant, Hegel und Heidegger nur ein Randthema, und ich war schon während des Studiums in China und Taiwan gewesen. Den letzten Anstoß lieferte ein Besuch im Jobcenter. Was ist passiert? Zur Überbrückung wollte ich Hartz IV beantragen, aber es stellen sich dort wohl nur selten promovierte Philosophen vor. Die erste Frage, die mir dort in einem bemüht positiven Tonfall gestellt wurde, war: „Wie sieht’s denn aus, haben wir eine abgeschlossene Schulausbildung?“ Wenn man gerade promoviert hat, ist das eine irritierende Frage. Ich habe, glaube ich, ein paar Monate Hartz IV bekommen, aber wollte nicht von staatlicher Unterstützung leben. Also bin ich in ein anderes Land gegangen, weil es dort bessere Verdienstmöglichkeiten geben sollte. Ich bin also ein Wirtschaftsmigrant. Warum sollte Ihnen Taiwan bessere Möglichkeiten bieten? Weil meine Themen hier interessieren. Aber leicht war es nicht, meine erste Stelle habe ich mit jemand anderem geteilt, hatte also nur ein halbes Einstiegsgehalt. Das waren vielleicht 500 Euro. Aber es gab immer irgendeine nächste Tür, die sich spaltbreit geöffnet hat. In Deutschland hatte ich das Gefühl, vor einer Mauer ohne Tür zu stehen. Mit 500 Euro kommt man in Taipeh vermutlich nicht sehr weit. Nein, auch weil die Mieten so stark gestiegen sind. Wir zahlen 1000 Euro für etwa 50 Quadratmeter. Wenn sie nicht Ingenieure in der Halbleiterindustrie sind, verdienen die Menschen hier nicht viel, weshalb sie oft sehr lange bei den Eltern wohnen. Immerhin: Man kann für sehr wenig Geld hier sehr gut essen. Was heißt „sehr wenig“? Sie kriegen eine sehr schmackhafte Mahlzeit schon für zwei Euro fünfzig. Wenn ich meine Wohnung verlasse, egal in welche Richtung, habe ich innerhalb von 200 Metern zehn verschiedene Etablissements, wo ich mir etwas zu essen kaufen kann. Da ist es witzlos, zu Hause zu kochen. Sie kochen nie? Wir haben gar keine funktionierende Küche. Wohnungen sind knapp, teuer und eng. In Taipeh ist es auch unüblich, sich gegenseitig zu besuchen. Ich komme nicht häufig in Privatwohnungen, weil die Leute tendenziell beengt wohnen. Man verabredet sich im Restaurant. Das Essen ist der absolute Mittelpunkt des Lebens in Taiwan. Mittlerweile werden Ihre Bücher auch in Taiwan gedruckt – w ächst da die Hoffnung, international wahrgenommen zu werden? Es ist natürlich der große Traum vieler Autoren, einen guten, namhaften Verlag in der angelsächsischen Welt für sich zu interessieren. Das erschließt nicht nur eine internationale Leserschaft und einen großen Markt, sondern ist auch ein Signal: Wenn jemand in London oder New York das einkauft, werden auch Verlage in Stockholm, Rom oder Madrid hellhörig. Aber es wird wahnsinnig wenig ins Englische übersetzt. Ich hatte mal ein Angebot für zwei meiner Romane, die als Doppelpack rausgebracht werden sollten. Leider ging der Verlag pleite, bevor das Projekt zustande kam. Bei meinem Buch „Pflaumenregen“ … … eine Art taiwanesischer Familiesaga … … hatte mein Verlag die Hoffnung, dass es gelingen könnte. Dann aber gab es eine ernüchternde Erfahrung: Es geht nicht, dass ein deutscher Mann einen Roman über eine taiwanische Familie schreibt. Als Suhrkamp da vorfühlte, stand sofort das Stichwort von der kulturellen Aneignung im Raum. Im Moment sind da alle wahnsinnig verängstigt, und es kam die Frage auf, ob wir ein „Sensitivity Reading“ gemacht hätten. Also, ob wir den Text jemandem gegeben haben, der befugt ist, zu beurteilen, ob etwas daran womöglich nicht ganz koscher ist. Hat Sie das getroffen? Das ist zumindest etwas, das einen ein bisschen hilflos macht. Ich bin ja kein deutscher Autor, der sich plötzlich dachte: „Alle reden über Taiwan, jetzt schreibe ich einen Taiwan-Roman“, sondern ich habe zu dem Zeitpunkt schon seit 15 Jahren in Taiwan gelebt und die Sprache gelernt. Ich habe einen Roman über das Land geschrieben, in dem ich lebe, und über Leute, mit denen ich lebe und die ich liebe. Es war auch inspiriert von der Familiengeschichte meiner Frau. Die Frage, ob ich das kann oder nicht, die stand ja gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern ich habe einfach den falschen Namen und das falsche Gesicht, um das zu tun. Wobei die Frage ja legitim sein kann . Natürlich, die Debatte ist nicht sinnlos. Das, was Graham Greene über Vietnam schrieb, will man heute nicht mehr lesen – die Frauen sitzen da, und ihre Stimmen sind wie Vogelgezwitscher, so was. Hat das bei der Veröffentlichung in Deutschland eine Rolle gespielt? Merkwürdigerweise nicht. Mir ist keine Reaktion und Rezension bekannt, wo meine Herkunft gegen mich ins Feld geführt worden wäre. Eher im Gegenteil: Endlich erzählt uns jemand eine Geschichte aus Taiwan. Und je besser die Leute selbst Taiwan kennen, desto besser finden sie tendenziell das Buch. Zuletzt haben Sie einen Krimi geschrieben, davor auch Sachbücher. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Leser etwas durcheinanderkommen, wofür Sie stehen? Von dem Krimi hatte ich Suhrkamp vorher nichts gesagt, und sie waren bass erstaunt. Immerhin konnte es ich es gut erklären: Ich hatte das Buch geschrieben, als ich wegen Corona mehrere Monate nicht nach Taiwan einreisen konnte und ein Projekt suchte, an dem ich nicht zwei oder drei Jahre lang arbeiten würde. Aber es kamen dann schon auch Überlegungen zum Stichwort Markenkern beim Verlag auf. Darum erscheint der Krimi unter anderem Namen? Am Ende war es besser, dafür einen anderen Verlag und einen anderen Namen zu wählen: Stephan Schmidt, was mein richtiger Name ist. Und wie kam es zum Künstlernamen Thome? Das ist der Geburtsname meiner Mutter. Bei meinem ersten Roman glaubte man bei Suhrkamp, dass gewöhnliche Namen nicht so funktionieren, weil sie keinen Wiedererkennungswert haben, deshalb Thome. Aber da hat sich die Wahrnehmung auch verändert. Ist ein Krimi finanziell attraktiver? Es könnte schon ein zweites Standbein werden. Im Verhältnis zum Aufwand war es für mich gutes Geld, obwohl mein Vorschuss für das Genre eher gering war. Auch wir Autoren müssen diversifizieren. Und Sie haben jetzt das politische Buch über den Konflikt um Taiwan geschrieben. Aus der Sorge, dass er übersehen wird? Ich habe es auch geschrieben, um die Leute darauf hinzuweisen. Guckt dorthin, bitte, da braut sich etwas zusammen. Das ist bedrohlich, es betrifft uns. Aber in erster Linie ging es mir darum, den Konflikt zu erklären. Er ist sehr komplex, und man muss sich ein bisschen reinknien, aber man kann ihn verstehen. Gerade dreht sich die Welt besonders schnell und wild. Wie groß sind Ihre Sorgen, dass Taiwan übersehen wird? Es ist für Taiwan sehr wichtig, dass seine bedrohte Lage wahrgenommen wird. Aber ich beobachte einen Unwillen in Europa, gerade in Deutschland, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben schweren Herzens akzeptiert, dass Russland nicht nur ein toller Lieferant von Gas und Öl ist, sondern auch ein Aggressor, und jetzt müsste man nach China schauen, und unsere Abhängigkeit vom chinesischen Markt ist sehr groß. Aber wir sollten doch hinschauen.