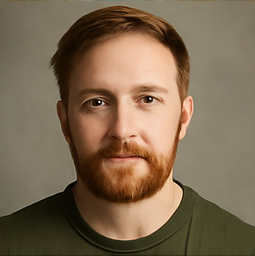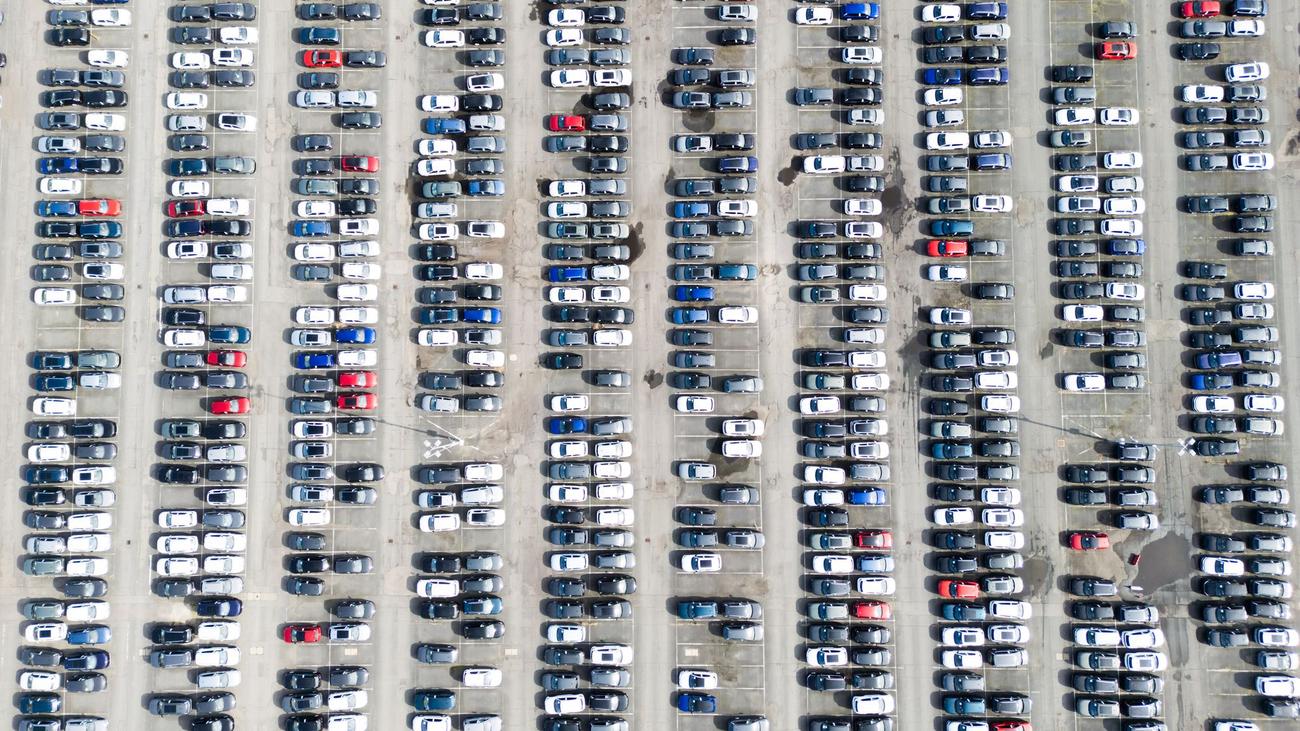DB-Regio-Chefin will "Deutschlandticket 2.0"

Mehrfach stand das Deutschlandticket in den vergangenen zwei Jahren unter Druck, mehrfach wurde über ein Ende diskutiert. Schwarz-Rot hat klargestellt: Das Ticket bleibt. Die Regio-Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, will diese Sicherheit nutzen, um das Angebot weiterzuentwickeln. Ein Interview Laura Czypull Rebecca Sawicki von Es sollte die Gesellschaft entlasten, als wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine und der damit verbundenen Gasmangellage im Sommer 2022 alles teurer wurde: das Neun-Euro-Ticket. Eine Fahrkarte, mit der Passagiere den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland nutzen konnten. Ein Gegenentwurf zum bisherigen Tarifdschungel aus Zonen-Karten, Monatskarten, Wochenend- und Ländertickets. Mehr News zur Innenpolitik Neun Euro kostet das Angebot zwar nicht mehr, mit dem Deutschlandticket ging am 1. Mai 2023 dennoch ein Nachfolger an den Start. Immer wieder stand das ÖPNV-Abo seither unter Druck, mehrfach wurde über ein mögliches Ende diskutiert. Mittlerweile ist klar: Das Ticket bleibt – die nächste Preiserhöhung soll laut Koalitionsvertrag erst 2029 kommen. Für die Regionalchefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, sind das gute Nachrichten. Die Sicherheit über den Erhalt des Tickets gebe nun Spielraum, das Angebot weiterzuentwickeln. Frau Palla, seit zwei Jahren gibt es das Deutschlandticket. Zeit für einen Blick zurück: Wie sieht Ihr Zwischenfazit aus? Evelyn Palla ist die Vorständin von DB Regio und damit für den Regionalverkehr zuständig. © picture alliance/dpa/Andreas Arnold Evelyn Palla: Das Deutschlandticket hat uns eine neue Freiheit im öffentlichen Nahverkehr geschenkt. Ein Ticket für alle Verkehrsmittel im ÖPNV, das in ganz Deutschland gilt – eine Revolution. Zudem kann es sich mit 49 Euro, beziehungsweise nun 58 Euro, die breite Masse unserer Gesellschaft leisten. Und wir haben mit dem Deutschlandticket dem ÖPNV einen Digitalisierungsschub verpasst! Das ist ein großer Erfolg, der sich auch in den Nutzerzahlen widerspiegelt. Inwiefern? 70 Prozent der Reisenden in Bussen und Regionalzügen der Deutschen Bahn sind inzwischen mit dem Deutschlandticket unterwegs. Insgesamt nutzen es aktuell 14,5 Millionen Menschen in Deutschland. 20 Millionen haben das Ticket schon irgendwann mal gekauft. Das Deutschlandticket soll laut Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot erhalten bleiben, jedoch perspektivisch ab 2029 teurer werden. Was hat sich bei der letzten Preiserhöhung im Januar in Sachen Nutzung und Fahrgastzahlen verändert? Die Auswirkungen waren sehr überschaubar. Die Anzahl der Nutzer ist im Januar zwar leicht gesunken, aber das haben wir im Januar vor einem Jahr saisonal-bedingt genauso beobachtet, ohne dass sich der Preis verändert hat. Wir müssen aber schon davon ausgehen, dass wir Nutzer verlieren, wenn es noch teurer wird. Spätestens, wenn das Monatsabo im jeweiligen Verkehrsbund wieder erschwinglicher ist als das Deutschlandticket. Aber wie groß der Effekt dann tatsächlich ist, lässt sich seriös nicht abschätzen, da wir ein vergleichbares Ticket noch nie hatten. Letztlich hängt die Preisentscheidung von der Politik ab. Wie meinen Sie das? Was viele nicht wissen: Das Deutschlandticket ist kein Ticket der Deutschen Bahn. Wir sind lediglich einer der vielen Vertreiber. Der Tarif ist ein öffentlicher Tarif, der ausschließlich vom politischen Willen abhängt und von Bund und Ländern finanziert und festgelegt wird. Im Koalitionsvertrag ist eine gute Basis für den Fortbestand des Tickets gelegt. Wie teuer könnte das Deutschlandticket aus Ihrer Sicht werden, um trotzdem noch sozial verträglich zu sein? Das ist schwer zu sagen. Es ist jedoch sinnvoll, irgendwann zu einem standardisierten Prozess der jährlichen Preisanpassung zu kommen. Den gibt es für alle anderen Tickets im ÖPNV, genauso wie bei anderen Produkten des täglichen Lebens ja auch. Im Bürgergeld sind aktuell 50,50 Euro für Mobilität vorgesehen. Eine Möglichkeit bestünde darin, das Ticket bei weiteren Preissteigerungen über einen Sondertarif finanziell benachteiligten Mitmenschen zur Verfügung zu stellen. Dabei geht es auch um die Verkehrswende. In Hamburg zum Beispiel gibt es mittlerweile mehr Deutschlandticket-Nutzer als angemeldete Autos. Haben Sie im Zusammenhang mit diesem Boom mehr Angebot auf die Schiene gebracht? Wie viel Angebot es im ÖPNV gibt, kann die Deutsche Bahn im Nahverkehr gar nicht entscheiden. Das Angebot des Regionalverkehrs wird von den Ländern bestellt. Wir bewerben uns und führen diese Bestellungen dann aus, wenn wir den Zuschlag erhalten. Das heißt, die Deutsche Bahn kann nichts für überfüllte Züge im Regionalverkehr zur Rushhour? Die Länder geben die Leistung sehr genau vor: Wie lang muss der Zug sein, wie viele Sitzplätze muss er haben, wie ist die Taktung? Wir haben hier keinen Handlungsspielraum. Aber natürlich gehen wir auf die Länder zu, wenn wir erkennen, dass das Angebot in bestimmten Zeiten besonders ausgelastet ist und die Kapazität nicht ausreicht. Beispielsweise im Sommer an den Wochenenden die Züge von Berlin an die Ostsee. Gemeinsam mit den Ländern versuchen wir dann, Lösungen zu finden und das Angebot für die Reisenden zu verbessern. Dafür braucht es auch ein funktionierendes Schienensystem. Das Sondervermögen für Infrastruktur könnte hier Abhilfe schaffen. Wie viel Geld erhoffen Sie sich aus dem Topf? Natürlich gibt es eine Bedarfsplanung von Seiten der Bahn. Wenn die Regierung gebildet ist, wird das Teil der Gespräche sein. 500 Milliarden Euro sind viel Geld – gleichzeitig gibt es aber auch viel Nachfrage nach dem Sondervermögen. Verkehrsminister Volker Wissing (parteilos) hat in der abgelaufenen Legislaturperiode das Infrastrukturprogramm Schiene an den Start gebracht. Durch den Bruch der Ampel gibt es jetzt aber eine Finanzierungslücke. Wie kann die ausgeglichen werden? Insbesondere durch das Sondervermögen Infrastruktur. Dadurch sind wir nicht mehr ausschließlich darauf angewiesen, dass der Bundeshaushalt genug Geld zur Finanzierung der Schiene bereitstellt. Das ist ein wichtiger Schritt, in den kommenden zehn bis zwölf Jahren ausreichend Finanzierung für die Schiene zu bekommen. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie viel am Ende bei uns ankommt: Eine Verbesserung für die Fahrgäste ist es in jedem Fall. Warum ist die Infrastruktur der Deutschen Bahn überhaupt so kaputt? Darüber ist ja schon viel geschrieben worden. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig Geld in unsere Schieneninfrastruktur investiert. In Österreich wird etwa dreimal so viel pro Bürger investiert, in der Schweiz sogar das Vierfache. Gleise, Weichen und Stellwerke sind die Grundlage für jedes funktionierende Eisenbahnsystem, da ist in Deutschland in den letzten Jahren sicherlich zu wenig getan worden. Das gilt es jetzt aufzuholen. "Generell müssen wir uns die Frage stellen, ob wir die Vielfalt unserer Verbundstrukturen mit dem Fortbestand des Deutschlandtickets noch rechtfertigen können." Evelyn Palla Zurück zum Deutschlandticket. Kritiker sagen: Es müsse erst ein Angebot bestehen, bevor man über Ticketpreise diskutieren kann. Was bringt das Deutschlandticket, wenn die Anbindung schlecht ist, die Züge regelmäßig ausfallen, überfüllt oder zu spät sind? Der öffentliche Verkehr kann nur funktionieren, wenn beides gut zusammenspielt. Wir brauchen einen attraktiven Preis und ein gutes Angebot. Darüber hinaus brauchen wir auch Verlässlichkeit und eine ordentliche Taktung im ÖPNV. Menschen lassen ihr Auto eher stehen, wenn die S-Bahn nicht nur einmal in der Stunde fährt, sondern alle 15 Minuten. Wir haben in Deutschland insgesamt ein vernünftiges Angebot – im städtischen Raum ist das natürlich deutlich ausgeprägter als im ländlichen. Dort müssen wir mehr Angebot schaffen, das ist klar. Das geht aber nicht ohne Zusatzfinanzierung von Bund und Ländern. Auch wenn das Deutschlandticket gut angelaufen ist, Verbesserungspotential gibt es immer: Welche Vorschläge haben Sie für die Zukunft des Angebots? Die vergangenen beiden Jahre waren die Einführungsphase, jetzt muss sich das Deutschlandticket weiterentwickeln. Wir brauchen ein Deutschlandticket 2.0 und dafür müssen wir verschiedene Themen angehen: Wir brauchen zum Beispiel eine einheitliche Tarifstelle – bis heute gibt es zu viele Unterschiede, mal darf man in einem Verbund sein Kind mitnehmen, mal den Hund, mal das Rad. Diese Regeln gelten immer nur bis zur Verbundgrenze. Einheitlich geht anders. Und gerade die Einheitlichkeit und die deutschlandweite Gültigkeit sind ja die große Stärke des Tickets. Und ansonsten? Natürlich wollen wir das Ticket noch besser vor Betrugsfällen absichern und noch mehr Nutzer für das Deutschlandticket gewinnen. Insbesondere beim Jobticket haben wir das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Generell müssen wir uns die Frage stellen, ob wir die Vielfalt unserer Verbundstrukturen mit dem Fortbestand des Deutschlandtickets noch rechtfertigen können. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob wir die Vielfalt der Tarifstrukturen im ÖPNV tatsächlich noch brauchen. Wie meinen Sie das? Viele Ticketkategorien werden durch das Deutschlandticket nicht mehr nachgefragt. Dasselbe gilt für die Automatenlandschaft: Seit es das Deutschlandticket gibt, sind die Umsätze an den Automaten rapide gesunken – sie anzuschaffen und zu unterhalten ist aber sehr teuer. Gerade im Ticketvertrieb brauchen wir einen weiteren Digitalisierungsschub im ÖPNV. Da können wir wunderbar auf das Deutschlandticket aufsetzen. Wenn wir es richtig machen, hat dieses Ticket das Potenzial, den ÖPNV moderner und deutlich effizienter zu machen.