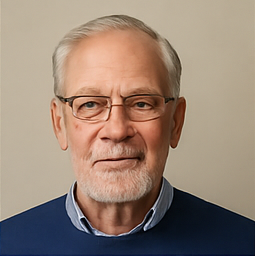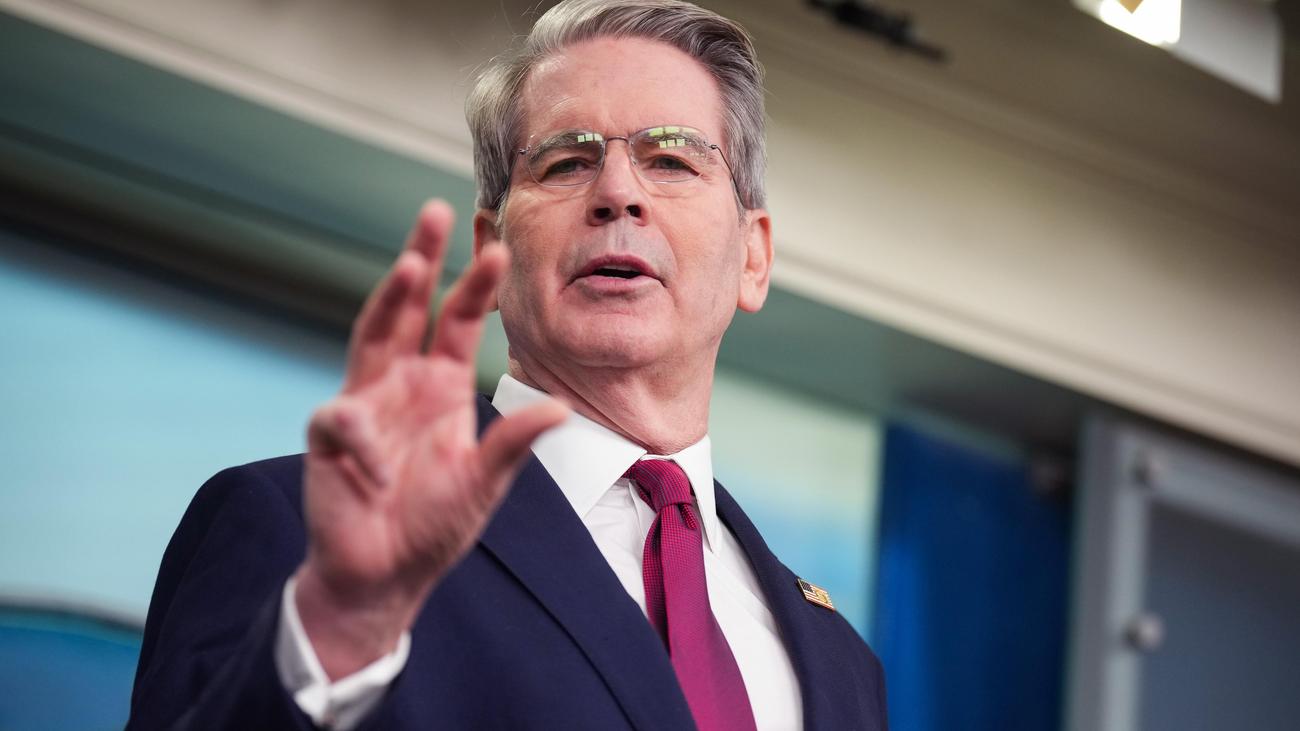Acht Erwachsene und ein Baby – zu Besuch in einer Gross-WG im Zürcher Seefeld

Mitmenschen sind eine Zumutung. Sie setzen sich im Tram ungefragt neben einen, kauen Kaugummi mit offenem Mund und lassen das Klo ohne Klopapier zurück – als wären sie allein auf der Welt. Wie sagte Jean-Paul Sartre? Die Hölle, das sind die anderen. Kein Wunder, lebt in der Stadt Zürich bald in der Hälfte aller Haushalte nur noch eine Person. Morgens vor dem ersten Schluck Kaffee schon gestört zu werden – wer tut sich das an? Und doch: Die WG ist wieder populär. Immer mehr Menschen teilen sich Küche, Bad und WLAN – aus Not, aus Trotz, aus Sehnsucht. Die einen, weil nach der Trennung das Geld knapp wurde. Die anderen, weil man sich die 6000-Franken-Designwohnung nur zu dritt leisten kann. Und wieder andere, weil der Alltag allein zu still ist. Oder zu leer. Mama, Papa und sechs Mitbewohner Bei Sara trifft nichts davon zu. Keine Geldnot, kein Platzmangel, keine stille Sehnsucht nach Gesellschaft. Die 32-Jährige lebt mit ihrer Tochter Zoé, ihrem Partner Simon und sechs Freunden unter einem Dach – freiwillig, überzeugt, begeistert. «Weil es das Beste ist, was einer Kleinfamilie passieren kann», sagt sie. Acht Erwachsene und ein Kind – klingt zuerst einmal nach logistischer Apokalypse. Die Tür geht auf zu einem Zuhause, wie man es in Zürich selten findet: sieben Schlafzimmer, vier Badezimmer, zwei Küchen, ein Wohnzimmer, Büro, Esszimmer – und genug Raum, um Nähe auszuhalten. Das 300 Quadratmeter grosse Haus könnte auch irgendwo auf dem Land sein. Doch es steht an einer der teuersten Lagen der Stadt. Der See ist zehn Fussminuten entfernt, ein Park beginnt gleich hinter dem Küchenfenster. Drinnen kreuzen sich MacBooks und Kinderspielzeug, Kochdämpfe und Zoom-Calls, Alltag und Idealismus. «Als ich schwanger wurde, war klar, dass Simon und ich zusammenziehen würden», erzählt Sara und greift nach ihrer Kaffeetasse. Es ist Dienstag, nach dem Mittag. Die Küche ist aufgeräumt, der Esstisch leer, hier liegen weniger Dinge herum als in manch einem Single-Haushalt. Sogar Zoés Spielzeugküche steht fein säuberlich zusammengestellt in der Ecke, als wäre sie nur zur Dekoration da. Im Haus ist es still an diesem Nachmittag im April, einzig die Fussböden knarren, und die kalte Frühlingsbise pfeift durch die alten Mauern. Als klar war, dass sie Eltern wurden, wohnte Simon mit zwei Freunden zusammen, Sara mit den Leuten, die jetzt mit ihnen leben. Für das Paar war nie die Frage, ob WG, sondern welche. Sie entschieden sich für den Grosshaushalt. Auch wenn der Platz damals knapp war. Anfänglich hatten sie nur ein Zimmer für sich als Familie – das damalige Haus war schlicht zu klein für acht Leute und ein Baby. Doch nach einem halben Jahr zog die WG kurzerhand kollektiv um. «Das war alles etwas turbulent», erzählt Sara. Zwei Wochen Zeit, um Kisten zu packen, einen Nachmieter zu finden und den Umzug zu organisieren. Aber alle packten mit an. Weil alle wollten, dass das Experiment weiterging. Der Alltag im Rudel Im neuen Haus hat die kleine Familie nun drei Zimmer für sich, die miteinander verbunden sind – Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer. Wie eine kleine Wohnung, nur ohne Küche. «Zu Beginn verstanden viele im Umfeld unsere Wohnsituation als Übergangslösung», sagt Sara. Mit Kind in der WG? Für viele unvorstellbar. Für Sara ein Leben, wie sie es sich erträumt hat. Fast immer ist irgendwer da, der kurz das Kind übernimmt, damit sie in Ruhe duschen kann oder einmal eine Minute für sich hat. Es gibt Gespräche mit Erwachsenen jenseits von Brei und Windeln. Jemand kocht. Und ihre Freunde sieht sie, ohne Termine auszumachen. Sie sind einfach da. «Ein Abendessen mit der Familie ist gleichzeitig auch ein Znacht mit Freunden», sagt sie. Selbst an einem gewöhnlichen Dienstagabend. Der bunte Tripp-Trapp-Stuhl fügt sich nahtlos zwischen die zusammengewürfelten Esszimmerstühle. Für die zweijährige Zoé ist die WG längst Familie. «Wenn wir in den Ferien sind, fragt sie, wo die anderen sind», erzählt Sara, sie sind Spielkameradinnen, Tröster, Publikum. Das Einzige, was sich Sara wünscht, wäre ein zweites Kind im Haus. Heute ist die Grossmutter aus Bern zum Hüten da. Sara muss für ihr Masterstudium in Schulmusik II noch ein Stück fertigstellen. Und später hätte eigentlich noch ihre Klavierschülerin vorbeikommen wollen, die sie im Familienwohnzimmer unterrichtet – aber die Lektion fällt heute aus. Ein seltener Moment zum Durchatmen. Denn der Alltag ist dicht getaktet. Sara studiert Vollzeit, Simon arbeitet 70 Prozent. Ohne das Netz aus Familie und Freunden ginge es nicht. Es brauche ein Dorf, um ein Kind grosszuziehen, heisst es. Oder eine WG und zwei Grossmütter. Mehr «wir» statt «ich» Plötzlich scheint die WG, dieses gern gezeichnete Klischee aus dreckigem Geschirr, Schuhen als Stolperfallen und aufgedrehter Partymusik, wieder zeitgemäss. Ist sie das Comeback der Kommune – oder das Einfamilienhaus für Fortgeschrittene? Vielleicht ist sie vor allem eins: ein stiller Aufstand gegen das Prinzip Vereinzelung. Gegen die neoliberale Romantik des Selbstoptimierers, der alles allein stemmt und dabei irgendwann umfällt. Denn wer sein Zuhause teilt, teilt nicht nur Kühlschränke und WLAN, sondern auch Sorgen, Routinen, das tägliche Drama namens Alltag. Was also verrät uns das WG-Leben über unsere Gegenwart? Es erzählt von einem Bedürfnis, das bleibt, wenn andere Familienmodelle wanken: das Verlangen nach Nähe, Verlässlichkeit und einem «Wir», das über dem «Ich» steht. Zusammensein schafft Verbundenheit Yael, 29, war es, die die Idee zu dieser Gross-WG mit Freunden vorantrieb. Yael war es, die den Traum nicht nur träumte, sondern umsetzte. Das Haus, in dem die neun heute wohnen, gehörte ihren Grosseltern. Als einige Verwandte ihre Anteile im Bieterverfahren verkauften, überzeugte sie ihre Eltern und weitere Familienmitglieder, diese mit ihr zusammen zu erwerben und das Haus an ihre WG zu vermieten. Seit zwei Jahren wohnen sie nun hier, Yael und ihr Freund Juri, ihre Schwester Lynn und die anderen sechs: Corsin mit dem Ordnungsfimmel, seine Freundin, die ebenfalls Yael heisst, Merlin, der strikt gegen einen Ämtliplan ist, und die Kleinfamilie mit Sara, Simon und Zoé. Yael ist eigentlich ständig unterwegs. Wird in Zürich ein neues Lokal, ein Shop oder eine Galerie eröffnet, ist die Designerin fast immer dabei. Auf Instagram postet sie gefühlt gleichzeitig aus Basel, Paris, Mailand. Ihr gibt die Individualisierung unserer Gesellschaft zu denken: «Ich frage mich: Was ist in zehn, fünfzehn Jahren?», sagt sie. Wenn sie Kinder hat. Oder auch: wenn sie keine Kinder hat. Mit dem Thema Gemeinschaftlichkeit setzt sie sich schon seit längerem intensiv auseinander, auch in ihrer Arbeit. Gemeinschaft ist für sie kein Trendbegriff, sondern ein roter Faden – beruflich wie privat. Schon lange denkt sie darüber nach, wie sich Nähe im öffentlichen Raum gestalten lässt. An den Zurich Design Weeks etwa initiierte sie das Projekt «Togetherness Bench» – eine Bank im öffentlichen Raum, die zu spontanen Gesprächen unter Fremden einladen sollte. Inspiriert ist sie von der Ökonomin und Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom, die das Prinzip der Allmende – also das Teilen gemeinsamer Ressourcen – aus der Mottenkiste der Geschichte zurück ins Denken holte. Heute sind davon oft nur noch die danach benannten Bushaltestellen übrig. Doch das Prinzip lebt wieder auf – gerade in der Architektur, wo neue Wohnformen alte Ideen aufgreifen: teilen statt besitzen, füreinander statt nebeneinander. Die WG habe sie verändert, sagt Yael. Heute wisse sie, wie wichtig es sei, Konflikte anzusprechen. Sie sei toleranter geworden – da sie erst durchs Zusammenleben gesehen habe, womit andere kämpften. Junge Eltern mit Kind zum Beispiel. Während anderswo Menschen ihre Ängste längst mit Chat-GPT besprechen – dem billigsten Ersatztherapeuten der Gegenwart –, ist hier im Haus immer jemand da. Man trifft sich in der Küche und erzählt, was an diesem Tag alles so passiert ist. Was einen genervt oder gefreut hat. Das nehme auch Druck aus der Paarbeziehung, sagt Yael, weil sich die emotionale Last auf mehrere Schultern verteile – statt sich in Dauerschleife an eine einzige Adresse zu richten. «Das Schöne ist auch: Du erhältst verschiedene Feedbacks, unterschiedliche Meinungen.» Und es öffnet Türen, wo vorher bloss Echos waren. Das um 1850 gebaute Haus ist verschachtelt und verwinkelt. Überall tut sich wieder ein neuer Gang auf. Jede und jeder hat ein Zimmer. Je nach Quadratmeteranzahl kostet dies pro Person etwa 1200 Franken. Das ist weit weniger, als man in Zürich für eine Wohnung bezahlt, aber für die meisten ist es mehr, weil sie zuvor in günstigeren WG oder in Genossenschaftsbauten hausten. Die Entscheidung, hier zu leben, zusammen mit acht anderen, fiel bei niemandem aus finanziellen Gründen. Die WG war eine Phantasie, ein Experiment, und heute ist es ihr Zuhause. «The anti-social century» Gemeinschaftliches Wohnen erhält wieder Aufwind – nur die Statistik hat es noch nicht gemerkt. In Zürich blieb die Zahl der offiziell registrierten Wohngemeinschaften von 2014 bis 2024 fast unverändert. Der Grund liegt wohl weniger im Lebensstil als im Zählprinzip: Erst ab drei Erwachsenen gilt ein Haushalt als WG. Teilen sich zwei Miete, Alltag und manchmal auch den Kühlschrankinhalt, gelten sie statistisch als Paar. Was hingegen messbar explodiert, sind die Mieten: Laut der Plattform New Home kostet eine nichtgenossenschaftliche 4,5-Zimmer-Wohnung in Zürich mittlerweile im Schnitt 5090 Franken im Monat. Für Familien mit Kindern wird ein bezahlbares Zuhause in der Stadt damit zunehmend zur Fata Morgana. 2018 erklärte das Gottlieb-Duttweiler-Institut in einer Studie: «Wohnformen differenzieren sich weiter aus, kollektive Wohnformen gewinnen an Bedeutung.» Was die Autoren nicht ahnen konnten: dass uns bald eine Pandemie erreichen würde. Statt Halt in der Gemeinschaft fanden die Menschen plötzlich Sicherheit in der Isolation. Sie lassen sich die Pizza liefern, statt im Restaurant zu essen, streamen Filme zu Hause auf dem Sofa, statt ins Kino zu gehen, trainieren an der heimischen Hantelbank und nicht mehr im Fussballverein. Das Zuhause wurde zu einer Art Kraftort, einem Tempel für Me-Time. Das amerikanische Magazin «The Atlantic» nennt unsere Zeit «the anti-social century». Noch nie waren wir so oft allein. Zwischen steigenden Mieten, Solo-Binge-Watching und Fast Food steht damit eine Frage neu im Raum: Wie wollen wir eigentlich wohnen – und mit wem? Die modernisierte WG Die Idee der WG ist nicht neu. Schon im 19. Jahrhundert träumten Charles Fourier und Robert Owen von Phalanstères – gemeinschaftlichen Wohn- und Arbeitsmodellen, die das Private und das Öffentliche versöhnten. In Israel leben ganze Generationen im Kibbuz, in religiösen Orden teilte man Besitz und Pflicht, lange bevor es einen Begriff dafür gab. Die Pariser Kommune experimentierte mit neuen Formen des kollektiven Lebens, ebenso wie später die Hippie-Kommunen der 1970er Jahre und die Hausbesetzerbewegung in Westberlin oder Zürich. Immer wieder, wenn Gesellschaften Risse bekommen, taucht dieser Gedanke auf: dass man besser lebt, wenn man nicht allein ist. Nicht, weil es romantischer wäre. Sondern, weil es realistischer ist. Weil es das Menschliche nicht als Bürde, sondern als Ressource begreift. Und doch haftet der Idee der Gemeinschaft stets ein Misstrauen an – als müsse man sich entscheiden zwischen Nähe und Freiheit, zwischen Solidarität und Individualismus. Die Kommune hat immer auch den Geruch des Zwangs. Vielleicht weil es so wenige Bilder von geglückter Gemeinschaft gibt. Die neuen Erwachsenen-WG sind weniger ein politisches Statement als ein pragmatischer Hybrid: familiär, aber nicht kleinbürgerlich, offen, aber nicht beliebig. Ihre Wurzeln reichen tief zurück, auch wenn das MacBook, das auf dem selbstgebauten Bürotisch am Fenstersims liegt, anderes suggeriert. Freiwilligkeit als Fundament Es ist Sonntagmittag, und Merlin, 30, ist gerade dabei, eine der Zimmertüren abzuschleifen, damit sich diese wieder richtig schliessen lässt. Er doktoriert an der Konjunkturforschungsstelle der ETH. «Unsere Organisation ist recht dynamisch», sagt er und meint damit vor allem, wie sie sich die Aufgaben im Haus untereinander aufteilen. Im Kühlschrank herrscht keine Kleinstaaterei. Keine abgetrennten Abteile, keine acht Sorten Jasminreis mit Namensschild – nur ein gemeinsames Fach, ein gemeinsamer Einkauf. Abends kocht, wer gerade Zeit hat. Und es isst mit, wer zu Hause ist. «Für mich wäre es ein Stress, wenn alles so durchgeregelt wäre», sagt Merlin, weshalb er strikt gegen einen Ämtliplan ist. «Wir sind ein Erwachsenenhaushalt, da sollte es selbstverständlich sein, dass alle Verantwortung übernehmen.» Schliesslich gehe es auch hier wieder darum, sich gegenseitig solidarisch zu unterstützen: «Wenn jemand einmal eine intensivere Phase hat bei der Arbeit oder sonst wo, dann übernehmen die anderen eben in dieser Zeit etwas mehr – und später gleicht sich das wieder aus.» Unter der Woche sieht das so aus, dass jeder und jede im Schnitt nur höchstens einmal kocht und sich an den anderen vier Abenden nach der Arbeit einfach an den Tisch setzen kann. Probleme untereinander glauben die Freunde keine zu sehen, aber sie alle betonen: Es muss in einer Gruppe schon sehr viel stimmen. In einer Wohngemeinschaft kann auch einiges schiefgehen. Man muss sich gut kennen, einander auch aushalten. Die für gewöhnlich grösste Streitquelle in WG – das Putzen – haben sie vorsorglich outgesourct: Einmal pro Woche kommt eine Reinigungskraft für die gemeinschaftlich genutzten Räume. Andere Konflikte probieren sie direkt anzusprechen. Zum Beispiel, wenn einer laut trampelt. «Probleme lassen sich viel einfacher lösen, wenn man zusammenwohnt», sagt Merlin. Lebt man alleine in einer Altbauwohnung, ist der Nachbar von oben vielleicht auch laut. Und dann? Sagt man nichts. Oder klopft mit dem Besenstiel an die Decke. Was meistens auch nichts nützt. Merlin ist in der WG besonders exponiert. Sein Zimmer befindet sich direkt neben dem Esszimmer, die Türe ist fast immer offen. «Ich bin gerne so mitten im Geschehen», sagt er. Aber es gebe auch Momente, da wünschte er sich etwas mehr Ruhe. «Wir sind deshalb ständig dabei, uns zu überlegen, was wir noch ändern könnten, um noch mehr Rückzugsorte zu schaffen.» Weil sie die Vermieter persönlich kennen, ist mehr erlaubt als üblich. In einer normalen Mietwohnung wäre schon eine zweite bunte Wand ein Affront – hier ist fast alles Verhandlungssache. «Wir schicken uns ständig Inspirationen, Moodboards und neue Materialien», erzählen Yael, Juri und Merlin, die auf Whatsapp eigens dafür einen Chat für ihre Baugruppe erstellt haben. Ihre Vision geht in Richtung Clusterwohnung, wie der Bereich von Sara, Simon und Zoé, die im ersten Stock mit den drei verbundenen Zimmern bereits viel Rückzugsraum für sich haben. Im Wohnzimmer hat die Baugruppe nach ihrem Einzug eine Wand hochgezogen. Dahinter befindet sich nun das Schlafzimmer von Yael und Juri. Auch das Badezimmer renovierten sie, mit neuen Fliesen und Armaturen, und die Küche ergänzten sie um eine zweite Theke, damit auch einmal mehr Leute zusammen kochen können. Der Traum vom Eigenheim – mitten in der Stadt Hier im Seefeld, einem der teuersten Quartiere der Stadt Zürich, leben die neun den idyllischen Traum vom Eigenheim. Sie züchten Tomaten im eigenen Garten und holen die Eier auf dem benachbarten Bauernhof. Ihr Haus sieht aus wie ein gewöhnliches Haus. Nur dass alles grösser ist, der Garten, der Esstisch, der Beamer, die Olivenölflasche. Und im Eingang stapeln sich die Schuhe – nicht irgendwie, sondern fein säuberlich aufgetürmt. Die Gross-WG passt zu einer Generation, die wieder häuslicher wird, heimlich vom Einfamilienhaus träumt, auch wenn ihr das Geld dafür fehlt. Geteilt wirkt der Spiessertraum gleich weniger bünzlig. Eher ausgefallen, irgendwie mutig auch. Frage in die Küchentischrunde: So eine WG hält einen doch auch jung? Die Freunde schauen sich an, kurz ist es still, dann lachen sie. Nun ja, sagen sie, manchmal müssten sie sich fast zwingen, abends noch aus dem Haus zu gehen. Sie seien halt schon einfach sehr gern zusammen – daheim. Sartre schrieb, dass die Hölle die anderen seien. Aber er vergass zu sagen, dass die Hölle ohne die anderen vielleicht auch nur ein gut isolierter Albtraum ist. Ein Artikel aus der «NZZ am Sonntag