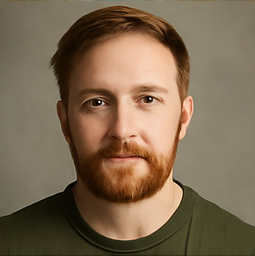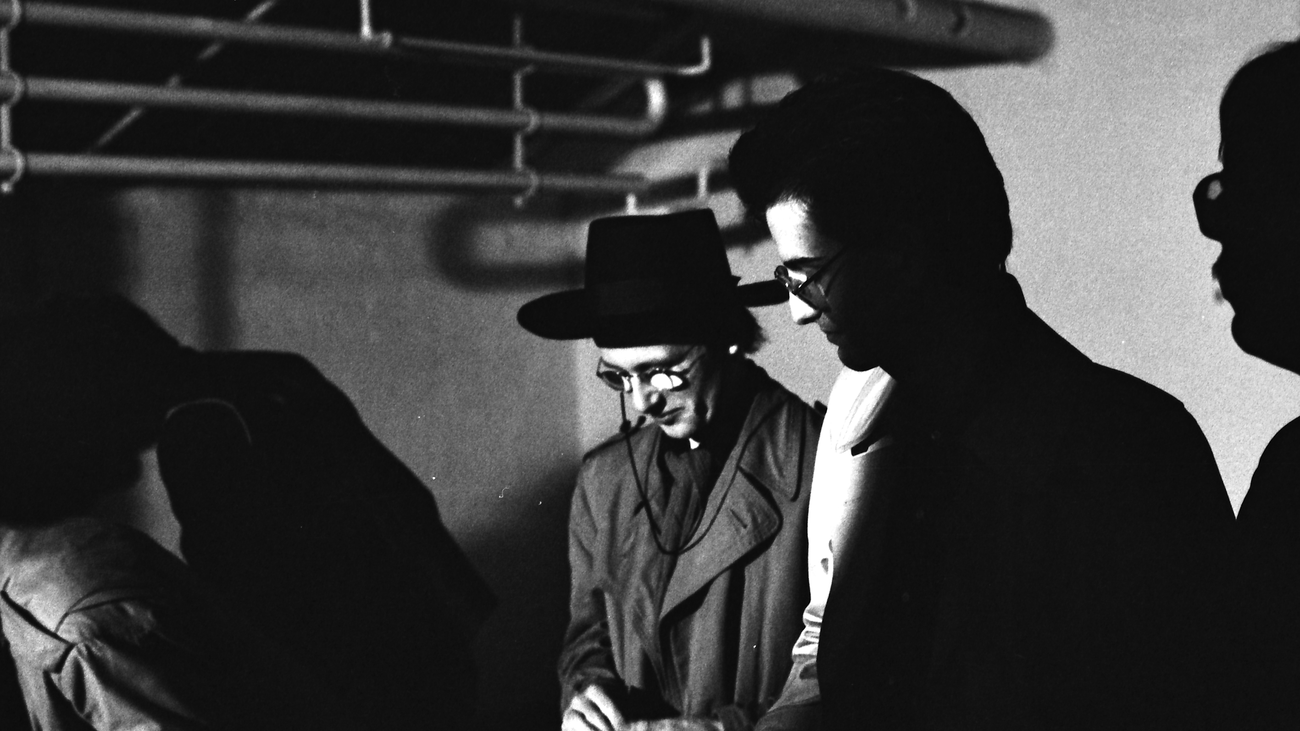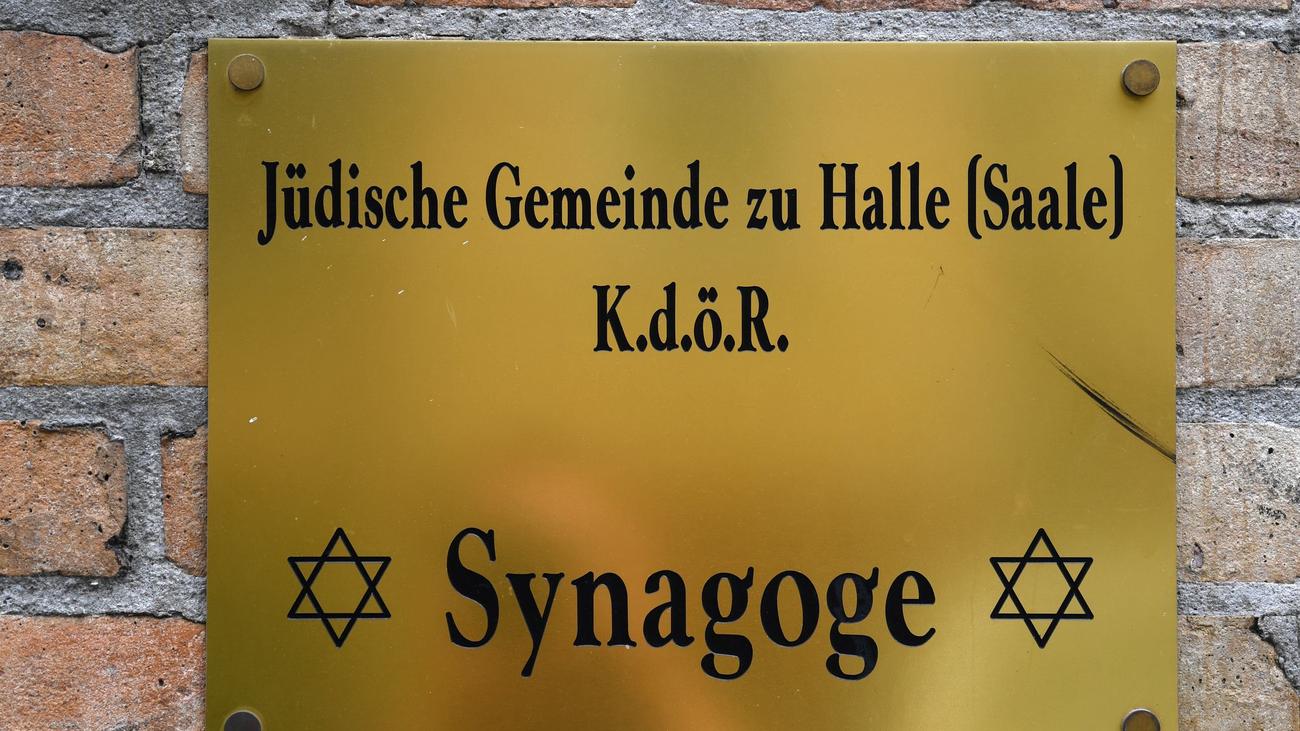Gespräche im Zug: Zuggeflüster

Bei allem Respekt vor Daniel Glattauer – aber sein neuer Roman (natürlich wieder ein Bestseller) In einem Zug hat einen völlig unrealistischen Plot. Darin trifft ein etwas abgehalfterter Autor von Liebesromanen während einer Zugfahrt eine Therapeutin, es fängt recht harmlos an, am Ende geht es um die Lebe, seine Ehe und das Leben. Das ist das Setting für 200 Seiten. Klingt wenig originell, ist jedoch recht unterhaltsam. Aber mal ehrlich: Wie realistisch ist es, dass man heutzutage in einem Zug noch wirklich in ein ausuferndes Gespräch mit Fremden kommt? Früher förderte die Architektur der Abteile, inspiriert von Postkutschen, Gespräche unter Reisenden. Auch ich bin während meiner wöchentlichen Fahrten zwischen Innsbruck und Wien immer wieder ins Plaudern gekommen – über Musik, den Job, das Wetter oder halt die aktuelle Verspätung. Heute sitzen wir in Zweierreihen, isoliert durch WLAN und Noise-Cancelling-Kopfhörer. Und mit dem Gefühl, dass eh keiner mit keinem etwas zu tun haben will. Glattauers Held Eduard Brünhofer liebt zwar die Menschen – "aber eher schriftlich und durchaus in ihrer Abwesenheit", sagt er schon auf Seite 18. (Spoiler: Er kann sich seines Gegenüber dann doch nicht so recht erwehren.) So geht's uns irgendwie allen – zumindest glauben wir das. Dabei sehnen wir uns nach Verbindung. Wir tun im Zug das Gegenteil dessen, was uns guttäte Vorweg: Ich bin selbst Teil dieser digitalen Zombiegesellschaft. Ich tippe diese Zeilen im Zug zwischen St. Pölten und Amstetten, glotze ins Laptop und trage Kopfhörer, um die zwei leicht angeheiterten Herren hinter mir auszublenden, die ihre Gedanken zum Papstbegräbnis ausbreiten und zwischendurch undefinierbare Melodien pfeifen. Dabei fände ich es eigentlich ganz nett, mich zu ihnen zu setzen. Vielleicht würden sie mir sogar ein Bier abtreten. Aber ich tue es nicht. Fast niemand tut das mehr. Und das ist nicht nur so ein Bauchgefühl von mir. Die amerikanischen Verhaltensforscher Nicholas Epley und Juliana Schroeder haben dazu im Jahr 2014 eine Untersuchung gemacht. Die beiden haben Teilnehmer ihrer Studie dazu angehalten, in öffentlichen Verkehrsmitteln ins Gespräch mit anderen Menschen zu kommen. Und siehe da: Wer mit Fremden spricht, ging zwar mit einem mulmigen Gefühl in die Unterhaltung, hatte Sorge, es könnte unangenehm oder peinlich werden – war danach aber glücklicher. Wir tun beim Zugfahren also genau das Gegenteil davon, was wir eigentlich wollen und was uns guttäte. Epley sagte zu dieser Studie einmal in einem Interview: "Sie haben Mitglieder der sozialsten Spezies des Planeten (falls Sie rätseln: Er meint die Menschen), die jeden Morgen in den Zug steigen, und anstatt einander wie Mitmenschen zu behandeln, neigen sie dazu, einander wie Felsen zu behandeln." "Mistakenly Seeking Solitude" heißt der Aufsatz von Epley und Schroeder, der im Jahr 2014 über ihre Untersuchung erschienen ist. Wir suchen also fälschlicherweise das Alleinsein. So, und was machen wir jetzt mit der Erkenntnis? Die misanthropische Attitüde von Glattauers Protagonisten Brünhofer spiegelt schon recht gut wider, wie wir alle irgendwie sind: keine Menschenfeinde, aber im Zweifel doch lieber distanziert. Und an WLAN, Laptop und Kopfhörer klammern wir uns nicht, weil es Teufelszeug ist, sondern ziemlich praktisch. Und trotzdem mache ich für heute Schluss damit. Ich klappe den Laptop zu und die Kopfhörer kommen runter. Gerade sind wir aus Linz abgefahren, und ich gehe jetzt zum Kaffeeautomaten, dem universellsten Ort der Begegnung überhaupt. Vielleicht finde ich ja wen zum Plaudern. Und wenn's unangenehm oder peinlich wird, habe ich wenigstens Stoff für die nächste Kolumne.