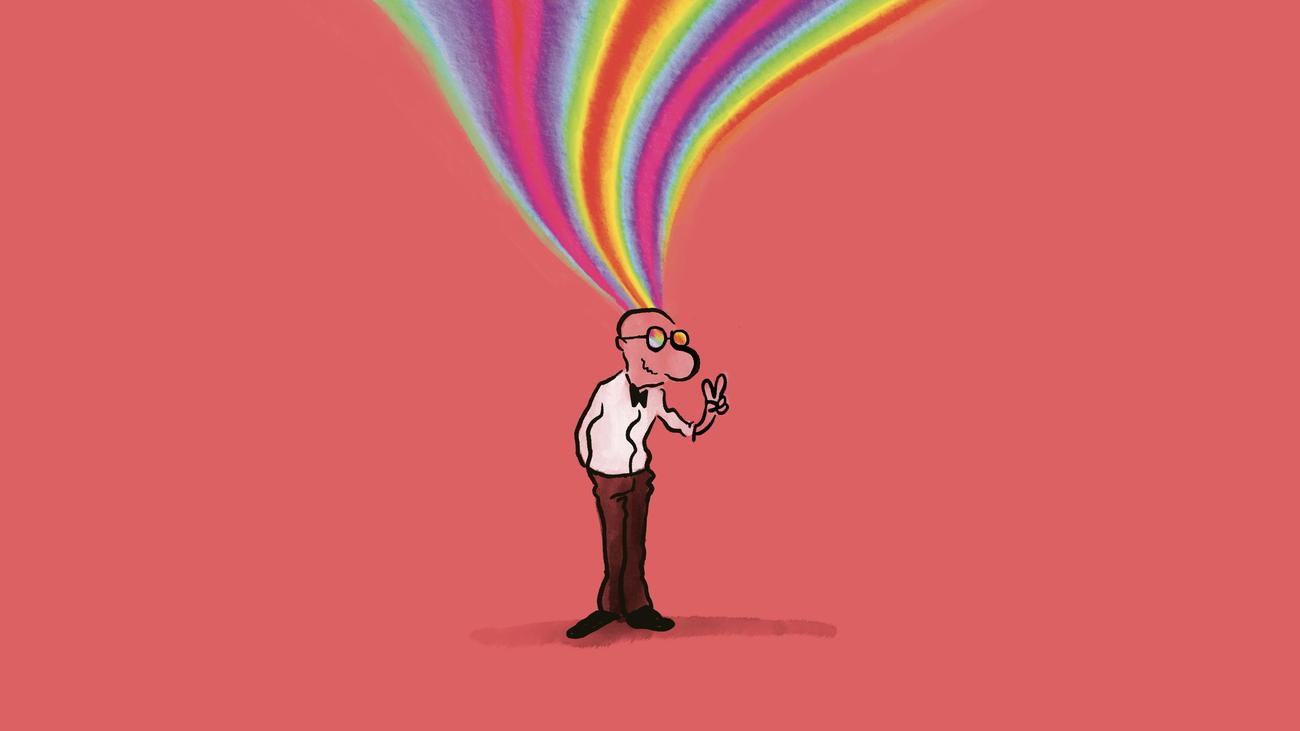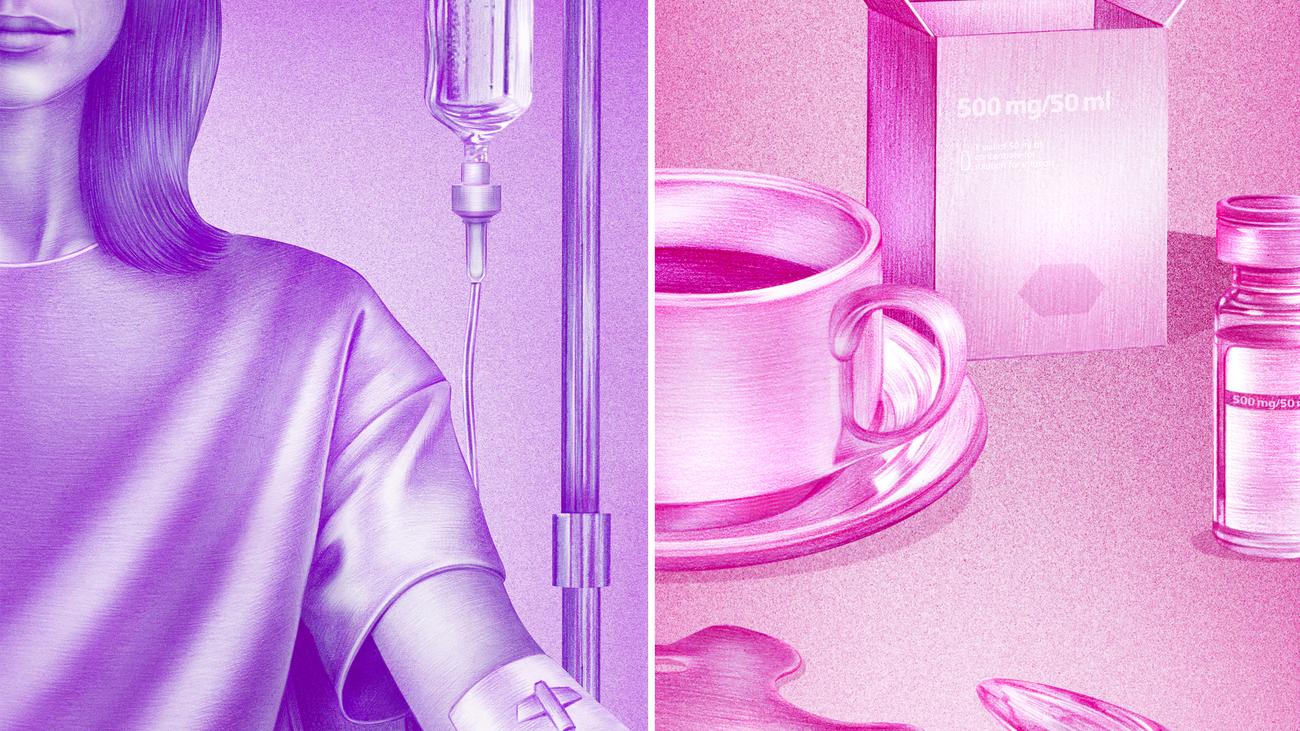Comic-Kolumne: „Zwei weibliche Halbakte“ von Luz

Im vergangenen Herbst war Luz in Köln. Wem das jetzt als nichts Besonderes erscheint, dem sei gesagt, dass der 1972 geborene französische Zeichner Luz (mit bürgerlichem Namen Réald Luzier) vor zehn Jahren zu den Überlebenden des Attentats auf „Charlie Hebdo“ zählte und nicht nur das Titelbild der aufs Massaker folgenden Ausgabe des französischen Satiremagazins gestaltet hat, sondern auch einige andere, in deren Figuren manche den Propheten Mohammed erkennen wollten – und es waren ja radikale Islamisten, die das Blutbad angerichtet hatten. Also stand Luz zehn Jahre lang unter Polizeischutz und lebte im Verborgenen. Nach Köln war er im Herbst mit einem Leibwächter gekommen, und die Zahl der über seinen Besuch Eingeweihten war klein. Luz wollte in Köln ein Museum besuchen, deshalb wurde ein Montag gewählt – Schließtag fürs normale Publikum im Museum Ludwig, Zutrittsmöglichkeit nur für Mitarbeiter und eine Handvoll auf Stillschweigen verpflichtete Pressevertreter. In der Dauerausstellung des Museums hängt ein Gemälde von Otto Mueller, „Zwei weibliche Halbakte“, angefertigt 1919, eines der expressionistischen Hauptwerke des Hauses. Und Gegenstand des neuen Comics von Luz, der damals gerade vor seiner Veröffentlichung in Frankreich stand. Deshalb wollte der Zeichner das Bild noch einmal sehen. Und das Museum ermöglichte es ihm, denn natürlich war man stolz darauf, dass ein so bekannter Autor eines der eigenen Gemälde als Thema einer Geschichte ausgewählt hatte. Die Comic-Kolumne von Andreas Platthaus F.A.Z. Nun ist dieser Band auch auf Deutsch erschienen, und Luz ist zur Vorstellung ein weiteres Mal ins Museum Ludwig gekommen, doch in dem halben Jahr, das zwischen den beiden Kölner Terminen lag, ist viel passiert. Drei Wochen nach dem zehnten Jahrestag des Überfalls auf die „Charlie“-Redaktion wurde „Deux filles nues“, wie der Band im Original etwas indezenter heißt, auf dem Comicfestival von Angoulême als bestes Album des Jahres ausgezeichnet, und Luz nahm den Preis – den wichtigsten, der in Frankreich für Comics vergeben wird – persönlich auf der Bühne entgegen. Es war sein erster öffentlicher Auftritt, und der kürzliche Kölner Präsentationstermin ist nun auch vorher bekannt gemacht worden. Die Zeit im Versteck scheint endlich vorbei. Im Schicksal dieses Bild erkennt Luz das eigene Ohne sie hätte es diesen Band aber gar nicht gegeben. Dass Luz die Geschichte eines Gemäldes erzählt, ist seine Reaktion darauf, was ihm die eigenen Bilder eingebrockt haben. Auch Mueller war ein verfemter Mann, in den Augen der Nationalsozialisten ein „entarteter Künstler“, wobei er 1930 starb, also bevor die Nazis an die Macht kamen. Aber seine Bilder wurden dann in den Museen beschlagnahmt und verscherbelt. Auch „Zwei weibliche Halbakte“, das der Familie eines jüdischen Sammlers, Ismar Littmann aus Breslau, weggenommen worden war, die es nach dessen Tod versteigern lassen wollte. Aber beschlagnahmte „entartete Kunst“ konnte offiziell nur ins Ausland abgegeben werden. So wurde das Gemälde erst einmal in der berüchtigten Ausstellung „Entartete Kunst“ gezeigt und sollte dann in Luzern auktioniert werden, blieb dort indes ohne Gebot und ging so zurück an einen der vier mit der Verwertung beauftragten deutschen Kunsthändler, der es unter der Hand an den berühmten Kölner Sammler Josef Haubrich verkaufte. Als dessen Stiftung kam es später ins Museum seiner Heimatstadt, um nach dem Krieg die vorherigen Moderne-Verluste durch Beschlagnahmung auszugleichen. Das Umschlagbild des Albums Reprodukt Natürlich ist die Geschichte des Bildes noch viel detailreicher – Entstehung, Lagerung, Restitution an die Littmann-Erben 1999, Wiedererwerb noch im selben Jahr fürs Museum Ludwig –, und Luz erzählt sie in kleinen Episoden vollständig nach. Der Clou des Comics ist jedoch nicht sein Gegenstand, sondern die Tatsache, dass dieser Gegenstand der Handlung tatsächlich buchstäblich gegenübersteht: Das Album „Zwei weibliche Halbakte“ ist aus der Sicht des gleichnamigen Bildes erzählt. Wir sehen nur das, was sich vor der bemalten Leinwand abgespielt hat. Was konsequentes Erzählen aus Bildersicht bedeutet Das hat zu Beginn schon den großartigen Effekt, dass nicht nur das Bild noch unfertig ist, sondern auch die Panels des Comics, die selbst nur als Fragmente ausgeführt sind, solange Mueller sein Gemälde nicht fertig hat. Und danach sieht man logischerweise über lange Strecken immer nur dieselben Raumausschnitte, je nachdem, was dem irgendwo herumstehenden oder hängenden Gemälde gegenüberliegt. Manchmal, wenn es irgendwo abgestellt ist, wie etwa in Lagerräumen oder beim Transport, sieht man kaum etwas. Oder wenn das Bild von den Nazis absichtlich schief gehängt wurde, um es als schlechte Malerei noch zusätzlich zu diskreditieren – dann stehen auch die Panels auf der Seite schief. Wir nehmen konsequent die Position des Bildes ein. Da das Bild, aus dessen Perspektive hier alles gezeigt wird, nicht nicht fertig gemalt ist, erscheint auch der Maler Otte Mueller vor der Leinwand nur in fragmentarischem Zustand. Reprodukt Und vor ihm werden uns all die Menschen präsentiert, die sich das Bild ansehen: der Künstler, das Modell, die Interessenten, der Käufer, dessen Angehörige, die Nazi-Gutachter, Goebbels und Hitler als Besucher der Depots mit „entarteter Kunst“, die Ausstellungsbesucher, die Versteigerer, das Auktionspublikum, die glücklichen und großzügigen Littmann-Nachkommen und am Ende all die Bewunderer des Gemäldes im Museum Ludwig, darunter einer, der als kleiner Junge schon in der Münchner Schandausstellung seinen Spaß an den halbnackten Mädchen auf dem Bild hatte und nun als alter Mann wieder. Luz zieht alle Register, nicht nur, was graphisches Erzählen angeht, sondern auch in den vielfältigen Querbezügen über die mehr als hundertjährige Geschichte des Mueller-Bildes hinweg. Denn so wie es altert, erneuert sich die Kunst. In den Ausstellungen und Versteigerungen „entarteter“ Werke ziehen viele andere berühmte Bilder an ihm vorbei, und im Museum Ludwig ist es dann konfrontiert mit Andy Warhol, Miró oder Niki de Saint-Phalle. Dieser Comic ist eine Lehrstunde in Kunstgeschichtsschreibung. Was im Comic ausgespart bleibt Eine höchst vergnügliche. Die jedoch manchen Lesern vergällt sein mag dadurch, dass Mueller seit Jahrzehnten im Gerede ist wegen Missbrauchs Minderjähriger – er gehörte der Künstlergruppe „Die Brücke“ an, die sich gerne halbwüchsiger Modelle bediente, und das allem Anschein nach nicht nur zum Malen. Diese heiklen Aspekte spart Luz aus, wobei ihm zugutekommt, dass seine Geschichte erst 1919 ansetzt, während die wilden Jahre der „Brücke“ im ersten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts lagen. Und Maria Mayerhöfer, die wohl das Modell für beide Mädchen auf dem Gemälde abgab, war bereits seit 1905 mit Mueller verheiratet. Hitlers Auftritt: Seitenblick auf die „Zwei weiblichen Halbakte“, zu finden im gleichnamigen Comic Reprodukt Bevor die deutsche Übersetzung erschien, zeigte die Galerie Huberty & Breyne in Paris eine Ausstellung mit den Originalzeichnungen von Luz. Da konnte man sehen, dass der Zeichner seine Panels jeweils auf den Rückseiten der Blätter angelegt hat, so dass er sie mittels eines Lichttischs dann auf der Vorderseite tuschen konnte – wobei zu beachten war, dass dadurch alles spiegelverkehrt wurde. Einige Originalseiten zeigen denn auch andere Panelabfolgen als die gedruckte Version, weil Luz sie erst nach Fertigstellung und Einscannen der Zeichnungen in die richtige Lesereihenfolge brachte. Man kann anhand solcher Präsentationen verstehen, was sich technisch verändert in der Comicproduktion – und was nicht. Oder zumindest nicht zwingend. Das Montagekunststück für den Druck Bei der Kolorierung etwa ist bei „Zwei weibliche Halbakte“ alles noch Handarbeit gewesen: aquarelliert auf dem Zeichenblatt. Dagegen unterscheiden sich die Panelformate oft vom gedruckten Buch, denn Luz zeichnete in der Regel nicht mehr als vier Panels pro Seite, die dann bei Bedarf verkleinert reproduziert und neu arrangiert wurden. Die ganzseitigen Bilder, die vor allem in der ersten Albumhälfte zu finden sind, wurden dagegen eher größer abgedruckt, als sie es im Original sind. Der Band ist also eine große Montagearbeit. Und die Sprechblasen sind überhaupt erst für den Druck im Computer hinzugefügt worden. Bei Luz verließen die Panels somit den Zeichentisch, als wären sie alle als kleine wortlose Aquarelle gedacht. Ganz klassisch.