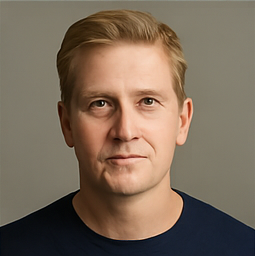Die AfD und der Verfassungsschutz: So wird die Partei nicht kleiner

Artikel anhören Kopiere den aktuellen Link Zur Merkliste hinzufügen Der Bundesverfassungsschutz stuft die AfD als "gesichert rechtsextremistische Bewegung" ein. Damit setzt eine gescheiterte Bundesregierung eine gescheiterte Strategie fort. An diesem Freitag, vier Tage vor der mutmaßlichen Vereidigung eines neuen Kanzlers, verkündete die scheidende Bundesinnenministerin, dass die größte Oppositionspartei rechtsextremistisch sei. Oder in der Behördensprache: Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die AfD als "gesichert extremistische Bewegung" ein. Damit hat die Bundespartei – so wie bereits die Landesverbände von Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt – die Karriere vom Prüffall über den Verdachtsfall zum Beobachtungsfall abgeschlossen. Der Verfassungsschutz, also der Staat, darf sie jetzt mit allen ihm zur Verfügung stehenden geheimdienstlichen Mitteln überwachen. Richtig ist: Die AfD ist eine teilweise rechtsextremistische Partei. Sie hat ideologische und persönliche Verbindungen in die gewaltbereite Szene. Und sie ist damit eine Partei, die das demokratische System gefährdet. Und dennoch erscheint an dieser nun verkündeten Entscheidung vieles fragwürdig: die Umstände, die Begründung – und vor allem die Strategie. Auf diese Art wird die AfD ganz bestimmt nicht kleiner. Das Wichtigste aus der Bundespolitik auf einen Blick Abonnieren Sie unseren kostenlosen Hauptstadt-Newsletter – und lesen Sie die wichtigsten Infos der Woche, von unseren Berliner Politik-Expertinnen und -Experten für Sie ausgewählt! Die Umstände: SPD-Innenministerin Nancy Faeser veröffentlichte am Freitag als eine ihrer letzten Amtshandlungen ein Gutachten, das tief in die Arbeit und Aufstellung der künftigen Bundesregierung eingreift. Ganz egal, ob die Entscheidung Faesers mit CSU-Nachfolger Alexander Dobrindt abgesprochen ist oder nicht: Der Zeitpunkt wirkt fatal. Faeser hatte das seit Monaten intern vorliegende Gutachten aus guten Gründen nicht im Bundestagswahlkampf oder während der Koalitionsverhandlungen veröffentlicht. Dass sie diese Zurückhaltung in den letzten Tagen ihres Amtes aufgab, lädt förmlich zu unguten Spekulationen ein. Aber nicht nur der Zeitpunkt ist bedenklich. Das Gutachten wurde erstellt unter Ex-Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldewang, der im November spontan entschied, für die CDU in den Bundestag gehen zu wollen. Die Kandidatur hob die Trennlinie zwischen Parteipolitik und Verfassungsschutz de facto auf. Dass Haldewang sein Amt ruhen ließ, ändert nichts daran, dass das Gutachten belastet ist. Und die Begründung? Der Verfassungsschutz teilte am Freitag mit: "Das in der Partei vorherrschende ethnisch-abstammungsmäßige Volksverständnis ist nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar." Es ziele darauf ab, "bestimmte Bevölkerungsgruppen von einer gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen" und sie abzuwerten. Konkret treffe es Migranten aus muslimisch geprägten Staaten. Diese Analyse lässt sich zwar kaum aus dem Programm, aber umso mehr aus internen und öffentlichen Äußerungen von AfD-Funktionären herleiten. So hat es vor einem Jahr auch zu Recht das Oberverwaltungsgericht in Münster festgestellt. Und das Gutachten bleibt geheim Dennoch handelt es sich am Ende um eine politische Entscheidung. Die Einstufung der kompletten Gesamtpartei als "gesichert rechtsextremistisch" wirkt noch pauschaler als die Einordnung etwa eines Landesverbandes in Thüringen, der von einem lupenreinen Rechtsextremisten wie Björn Höcke geführt wird. Noch undurchsichtiger macht den Vorgang, dass das Gutachten nicht veröffentlicht werden soll. Ansonsten zeigt das Beispiel Höcke eindrücklich, dass die bisherige Strategie nicht funktioniert. Denn es ist ausgerechnet der thüringische Landesverband, der seit Jahren Rekordergebnisse einfährt. Im Erfurter Landtag besetzt die AfD-Fraktion mehr als ein Drittel der Sitze, bei der Bundestagswahl kam die Thüringer AfD auf mehr als 38 Prozent. Kurzum: Je länger und intensiver der Verfassungsschutz die AfD beobachtet, umso stärker wird sie. Das ist erst einmal nur eine Korrelation. Aber vielleicht wäre es geboten, endlich ernsthaft über einen kausalen Zusammenhang nachzudenken – und die nötigen Fragen lauter zu stellen. Die Opfererzählung der AfD Zum Beispiel diese: Ist es wirklich gut, dass eine dem Ministerium nachgeordnete Innenbehörde, die eine lange Skandalgeschichte aufweist, eine Parlamentspartei politisch einstuft und überwacht? Oder diese: Wird damit das Vertrauen der Menschen in den demokratischen Wettbewerb und die staatlichen Institutionen zusätzlich geschwächt? Oder diese: Findet die Erzählung der AfD, dass sie das Opfer eines angeblichen "Kartells" sei, nicht damit eine unfreiwillige Bestätigung? Gewiss, es gibt darauf keine einfachen Antworten. Doch anstatt jetzt erneut eine fruchtlose Debatte über ein Parteiverbot zu beginnen, sollte noch viel mehr darüber geredet werden, was genau die AfD immer größer macht und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind, politisch, rechtlich und kommunikativ. Immerhin könnte es, wenn es richtig schiefläuft, im nächsten Jahr in Sachsen-Anhalt die erste AfD-Regierung geben.