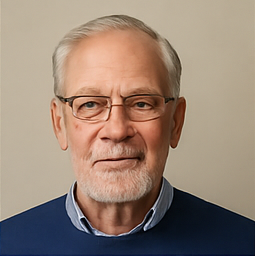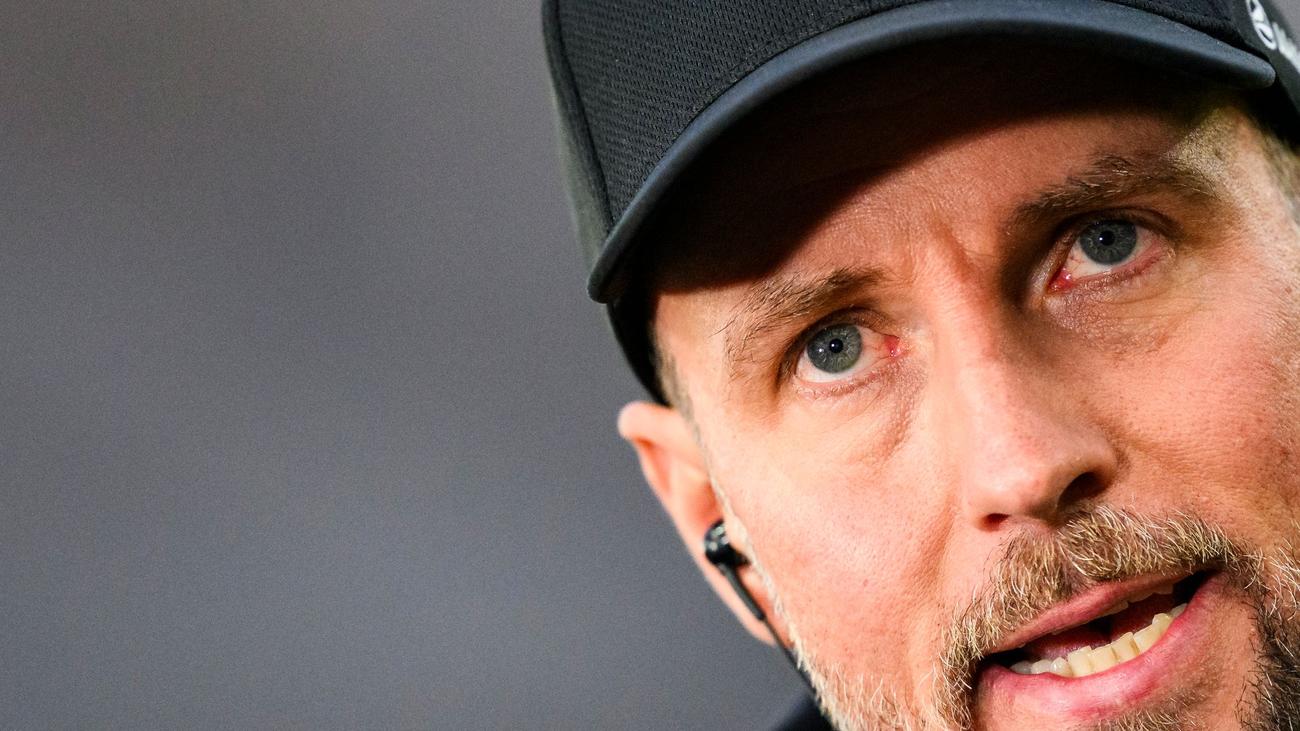Payment per QR-Code: Wie eine Softbank-Tochter sich in Japan durchsetzen will

Der Quick-Response-Code, kurz QR-Code, hat eine lange und spannende Geschichte. Masahiro Hara und Takayuki Nagaya erfanden den zweidimensionalen Matrix-Barcode, der sich äußerst leicht und vor allem schnell und fehlerfrei per Kamera auslesen lässt – und dabei dennoch ausreichende Datenmengen für viele Anwendungen (im schnitt gut 3 KByte) übertragen kann –, bereits 1994. Damals arbeiteten die beiden beim japanischen Automobilzuliefererunternehmen Denso, das für die Beschleunigung der Komponentenlogistik genauere Labels als einfache Barcodes verwenden wollte. Anzeige Japanische Erfindung erobert chinesisches Bezahlsystem Der Rest ist Geschichte: Das System wurde mehr und mehr optimiert, standardisiert und schließlich breit von einem diversen Publikum eingesetzt – spätestens mit der Durchsetzung von Smartphones, die eine Kamera mitbrachten. In Deutschland dienen QR-Codes heutzutage vielerlei Zwecken: vom Übermitteln einer URL für die Speisekarte im Restaurant über die Weitergabe von Rechnungsdaten an eine Banking-App bis hin zur Ticketkontrolle im Nahverkehr oder bei Konzerten. Auch Privatleute und Marketingmenschen nutzen die Technik, um schneller Content zu übertragen oder Menschen ins Web zu locken. Getreu dem Motto: Warum eine Web-Adresse eingeben, wenn es auch der Scan eines QR-Codes tut? Statt Inhalte abzutippen, scannt man nur noch. Was man hierzulande jedoch quasi gar nicht kennt, ist das Bezahlen mittels QR-Code. Während etwa in China QR-basierte Bezahlsysteme wie die von WeChat (Weixin) oder AliPay komplett alltäglich sind und Kreditkarten (samt ihren Ablegern auf Mobilgeräten) verdrängt haben, kommt es in Deutschland höchstens vereinzelt zu Payment-Anwendungen, beispielsweise bei QR-Zahlungen von PayPal- zu PayPal-Account. Ironischerweise galt die Nichtdurchsetzung von QR-Payments auch für die Heimat der QR-Codes selbst, nämlich Japan. Dort wurden lange reguläre Kreditkarten eingesetzt, die dann später auf i-Mode-Handys – aus heutiger Sicht Internet-fähigen Feature-Phones, die viele Jahre den lokalen Markt beherrschten – landeten. Später kam dann die Durchsetzung von E-Geld-Karten wie Suica, die recht früh auch auf iPhones genutzt werden konnten, plus hinterlegten Kreditkarten in Diensten wie Apple Pay und Google Pay auf Smartphones und Smartwatches, wie wir es aus Europa kennen. Das heißt: Es ist kompliziert, der Markt an Zahlungsmitteln in Nippon divers. Erst mit der Corona-Pandemie samt Trend zu kontaktlosen Bezahlungen und Programmen der japanischen Regierung, mehr Dienstleistungen zu digitalisieren, bilden sich echte Champions heraus. Softbank tritt auf den Plan – mit Hilfe aus Südkorea Im Reich der Mitte und weiteren Ländern Asiens (plus Globaler Süden) wurde hingegen auf QR-Payment konsolidiert, was man durch chinesische Touristen mittlerweile auch im Westen spürt, wo man die Logos von AliPay und WeChat Pay in großen Ladenketten inzwischen häufiger sieht. In der Volksrepublik lässt sich nahezu alles mit QR-Payment abwickeln. Egal, ob im Supermarkt, im Luxuskaufhaus, im Taxi, beim Fleischer oder gar beim Bettler auf der Straße: Überall wird mit WeChat Pay oder AliPay per QR-Code bezahlt. Die App wird gestartet, ein – oft schlicht ausgedruckter – Code gescannt, die Zahlung bestätigt, fertig. Zusätzliche Hardware bis auf ein Smartphone – etwa einen Kartenleser – brauchen weder Kunde noch Händler. Kein Wunder, dass die Japaner neidisch wurden, was mit ihrer Grundlagentechnik passiert. Beim wohl größten Digitalunternehmen des Landes, dem Softbank-Konzern, wollte man da nicht länger warten – und führte 2018 einen Dienst namens PayPay ein, der an dem ausgerichtet ist, was es in China gab. Gegründet wurde das Unternehmen unter dem Dach der LY Corporation, die verschiedene bekannte Internet-Marken wie Yahoo Japan (keine Verbindung mehr zur US-Mutter) und Line kombiniert und an der auch der südkoreanische Internetriese Naver einen Anteil hat. PayPay sitzt im Softbank-Hochhaus. (Bild: Ben Schwan / heise online) Die Idee hinter PayPay war einfach: Zu versuchen, den QR-Payment-Erfolg in China und anderen asiatischen Ländern im fragmentierten japanischen Bezahlmarkt zu replizieren, drumherum eine eigene App mit Loyalty-Programm zu bauen sowie durch eine eigene Bank profitable Finanzdienstleistungen anzuflanschen. Knapp sieben Jahre später muss man sagen, dass das auch gelungen ist: PayPay hat laut Angaben von LY Ende letzten Jahres 66 Millionen registrierte Benutzer gehabt. Wenn man bedenkt, dass Japan derzeit noch eine Bevölkerung von rund 123 Millionen Menschen aufweist, ist das ein gigantischer Erfolg. Gelungen ist diese Durchdringung der Bevölkerung erstens durch die Marktmacht, die LY durch seine im Land viel verwendeten Online-Dienste hat. Zweitens durch ein Umgarnen vieler, insbesondere kleinerer, Händler und Restaurantbetreiber mit günstigen Preisen und Kundendiscounts, die vorher gar nicht auf die Idee gekommen wären, bargeldlose Zahlungen anzubieten, denn lange war in Nippon Cash der (fast) einzige König. Anzeige Direkte Abbuchung vom Konto Der Ansatz von PayPay läuft auf eine Debitbezahlfunktion hinaus, die an das Konto des Kunden geknüpft ist. Das hat für PayPay und seine Finanztechnologiesparte den zentralen Vorteil, dass das Unternehmen nicht – wie bei einer klassischen Kreditkarte mit monatlicher Abrechnung oder Teilzahlung – in Vorleistung treten muss. Die Kunden verbinden ihr (japanisches) Bankkonto mit PayPay und identifizieren sich zweifelsfrei über ihre Bürgernummer. Anschließend wird direkt bei der Bezahlung per App und QR-Code abgerechnet. Um die Leute bei der Stange zu halten, gibt es besagtes Loyalitätsprogramm zum Punktesammeln und – besonders in der Anfangsphase von PayPay und zu wichtigen Jahresanlässen – Rabattschlachten, bei denen man beim Bezahlen mit PayPay ein bis niedrig zweistellige Prozentanteile sparen darf. Wer mit seinem Geld genau haushalten will und nicht in die Kreditfalle tappen möchte, freut sich darüber, dass die Abbuchungen direkt erfolgen. Menschen mit mehr Geld und/oder Kontrolle ärgern sich hingegen, dass sie keinen (bei monatlicher Komplettzahlung) zinslosen Kredit wie bei Kreditkarten bekommen. Letztlich begibt man sich bei PayPay somit in die Abhängigkeit der jeweiligen Bank, zu der das hinterlegte Konto gehört, und muss das japanische Äquivalent zum Dispositionskredit nutzen, wenn man mal knapp bei Kasse ist. WeChat Pay und AliPay arbeiten genauso: Über eine standardmäßige Sofortabbuchung vom Konto oder Guthaben. Softbank-Roboter Pepper: Je nach Jahreszeit wird er verschönert. (Bild: Ben Schwan / heise online) So nett und praktisch PayPay mit seinen vielen Annahmestellen in Japan auch ist, bei dem Dienst ergeben sich einige Probleme, wenn man eben nicht fest in Nippon lebt. Denn: PayPay erlaubt eine Registrierung eben nur mit japanischem Bankkonto samt Bürgernummer. Aufgrund der Debitfunktionsweise sieht das Unternehmen auch keine andere Art der Verwendung – etwa via hinterlegter Kreditkarte – vor. Kommt man als Tourist ins Land, ist man ausgeschlossen und sollte sich an andere Bezahlvarianten halten. Sei es nun die Kreditkarte physischer Art oder in Apple Pay und Google Pay – oder Suica und ihre Varianten wie Pasmo oder Icoca als physische Karte oder auf Smartphone und Smartwatch. Zwar sind auch Suica und Co. "echtes" E-Geld, das beim Ausgeben sofort abgebucht wird. Doch durch das Aufladen per Kreditkarte etwa auf einem iPhone hat man auch hier den Vorteil, erst später mit der Kreditkartenabrechnung zu zahlen. Hat sich ein Händler in Japan entschlossen, bei digitalen Zahlungen ganz allein auf PayPay zu setzen (was relativ selten ist), hilft dann nur noch Bargeld. Kompatibilität mit anderen QR-Payments Immerhin: PayPay ist sich des Problems mit dem Tourismus bewusst, zumal man Märkte zum Expandieren sucht. Zwar hat die LY-Tochter laut Angaben des Unternehmens derzeit nicht vor, ein eigenes Angebot für nicht in Japan lebende Menschen zu implementieren. Aber immerhin versuchen QR-Payment-Anbieter mittlerweile, untereinander kompatibel zu werden. So sind aktuell immerhin 19 andere "Cashless Services" aus 11 Ländern und Regionen der Welt an PayPay angeschlossen. Darunter sind AliPay aus China und das Netzwerk HIVEX, das selbst versucht, mehr Interoperabilität zu schaffen. Die PayPay-Kompatibilitätsliste ist aus Sicht Europas und Nordamerikas allerdings recht enttäuschend: Asien ist klar am stärksten unterstützt, sei es Südkorea, Singapur, Thailand, Taiwan, die Mongolei, Malaysia, die Philippinen oder eben China (Festland mit Hongkong und Macao). "Seit der Einführung unseres Dienstes im Oktober 2018 haben wir daran gearbeitet, ein Umfeld zu schaffen, das Händler dabei unterstützt, eine touristisch motivierte Nachfrage zu nutzen und gleichzeitig den Komfort solcher Reisenden zu erhöhen", betont das Unternehmen. Man sei an einer möglichst nahtlosen Implementierung interessiert. "Wenn Besucher mit kompatiblen bargeldlosen Zahlungsdiensten über PayPay-QR-Codes für Waren und Dienstleistungen bezahlen, können die Beträge nach Eingabe des Preises in Yen automatisch in lokale Währungen umgerechnet werden." Dies solle für ein stressfreies Einkaufserlebnis sorgen. "Und auch die Händler profitieren von einer reibungslosen Interaktion mit touristischen Gästen." Getränkeautomat in Tokio: PayPay geht hier auch. (Bild: Ben Schwan / heise online) Das Problem: Der Westen ist wie erwähnt außen vor. Aus den USA oder Kanada findet sich – auch weil QR-Payments dort kaum bekannt sind – kein einziger Anbieter, der zu PayPay kompatibel wäre. In der EU ist immerhin Italien dabei: Tinaba von der gleichnamigen Neobank Tinaba S.p.A und ihrer Mutter Banco Profilo. Aber auch hier ist man als Deutscher nicht wirklich gewollt. Tinaba bietet zwar eine englische Informationswebsite, vertreibt ihre App aber allein im italienischen App Store und erwartet augenscheinlich Kunden, die in Italien auch ihren Wohnsitz haben. Hier kann man einmal mehr sehen, dass der EU-Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen noch nicht vollständig hergestellt ist: Banken und Kreditkartenausgeber dürfen nach wie vor selbst entscheiden, welche Kunden aus welchen Mitgliedsstaaten sie versorgen wollen, statt dass sich EU-Bürger in allen Ländern das jeweils beste Angebot heraussuchen dürfen. Bei PayPay würde man gerne mit weiteren Partnern kooperieren, doch die muss es natürlich erst einmal geben. Da es in Japan jedoch weiterhin ein großes Ökosystem an alternativen Bezahlmethoden ohne QR-Code gibt, muss das Besucher zunächst nicht stören. Anders sähe es aus, wenn PayPay einmal eine ähnliche Marktmacht erhielte wie AliPay und WeChat Pay in China. (bsc)