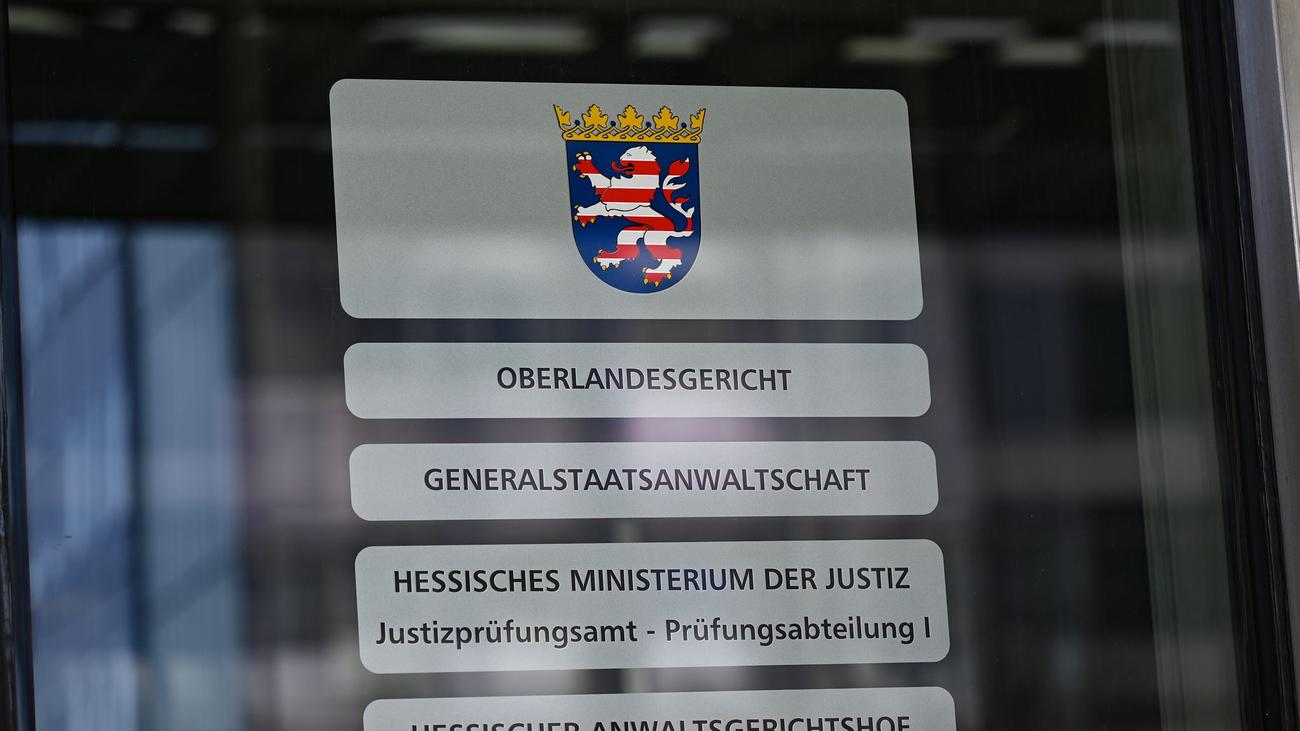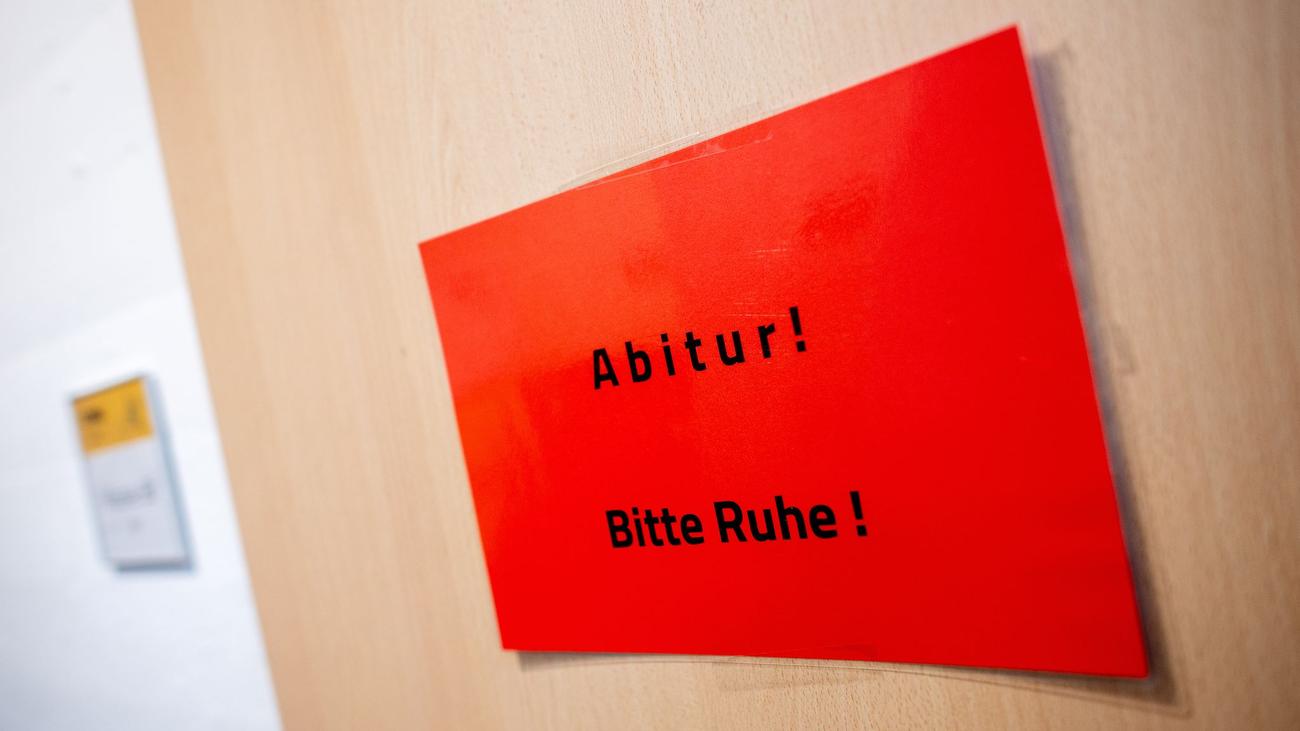SAP-Vizepräsident: "Daten sind wie Öl, in reinem Zustand nicht nutzbar"

"Daten sind weniger wie Gold, sondern vielmehr wie Öl [...]. In reinem Zustand sind sie nicht nutzbar". Den Vergleich zog Michael Byczkowski, Global Vice President und Head of Healthcare Industry von SAP, auf dem Digital Health Innovation Forum des Hasso-Plattner-Instituts (HPI). Dabei räumte er ein, dass der Vergleich vielleicht etwas aus der Mode gekommen sei. Allerdings müssten Daten gesammelt werden, wozu "gute Systeme" erforderlich seien, sagte er in seiner Keynote "Capturing Value from Health Data: Platforms, Markets, and the Potential of Software-Defined Healthcare". Anzeige Lesen Sie auch Merkel: Wirtschaft muss bei Nutzung von Daten aufholen Der klassische Ansatz sei es, dass ein Krankenhaus ein Gerät kauft, optimiert und für Forschungszwecke speziellen Zugriff auf die API des Geräts erhält. Dann werden Daten gesammelt und Analysen durchgeführt. Als Alternative bezeichnete er den datenbankbasierten Ansatz, wonach man die Daten des Krankenhauses erhält, analysiert und neue Ideen entwickelt. Alle bisherigen Ansätze seien jedoch begrenzt und würden laut Byczkowski nicht skalieren. Aktuell beginne der Wandel zur "Software Defined Healthcare", bei der hardwarezentrierte Prozesse und Systeme durch softwaregesteuerte Prozesse ersetzt werden. Erweiterbare Cloud-basierte Plattform Als Beispiel für eine offene und erweiterbare, Cloud-basierte Plattform führte Byczkowski das Projekt "OP 4.1" auf. An dem "Operationssaal der Zukunft" wirkten unter anderem SAP, die Siemens Healthineers, das urologische Universitätsklinik Heidelberg und das Deutsche Krebsforschungszentrum mit. Ziel war es, chirurgische Prozesse zu verbessern und speziell die Sicherheit der Patienten zu fördern sowie die Arbeitsbelastung des medizinischen Personals zu reduzieren. Dabei sei das Universitätsklinikum Heidelberg auf SAP zugekommen. Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Das Projekt wurde vor mehr als fünf Jahren vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als Teil des Programms "Smart Service Welt II" gefördert. Denn es ging laut Byczkowski um ein wirtschaftliches Problem: "Wie bringt man Gerätehersteller, Softwareentwickler und Krankenhäuser zusammen?". Dabei ginge es nicht um Technologie, sondern darum, verschiedene Parteien zusammenzubringen. Anzeige "Wir entwickeln keine Medizinprodukte und Software an sich, sondern haben einen wirklich vielseitigen Markt geschaffen", so Byczkowski. Softwareentwickler können APIs nutzen, dafür eine bestimmte Gebühr bezahlen und Machine-Learning-Algorithmen entwickeln, ohne selbst beispielsweise über ein CT zu verfügen. Das sei allein mit Software möglich. Entwickler könnten dann ein Software-Add-on für ein medizinisches Gerät entwickeln und das dann an das Krankenhaus verkaufen. Das eröffne einen vielseitigen Markt und sei innovationsfördernd, erklärte Byczkowski. Damit könne die Software sich viel schneller weiterentwickeln, die Firmware müsse nicht geändert und keine neuen Geräte gekauft werden, wobei die Plattform dabei offen sei. Auch neue Zahlungsmodalitäten könnten so möglich werden, etwa "Pay-by-Outcome" oder "Pay-by-Use". Schemazeichnung des datengetriebenen Business-Netzwerks von SAP (Bild: SAP) Für die Forschung sei das "großartig". Geräte müssten nicht mehrfach gekauft werden, sondern die Nutzungsdauer könne für ein bestimmtes Gerät festgelegt werden. Das Ganze könnte natürlich auch für kommerzielle Zwecke genutzt und bei Bedarf erweitert werden. Lesen Sie auch Lobbyregister: Diese Firmen geben am meisten für Lobbyarbeit aus (mack)