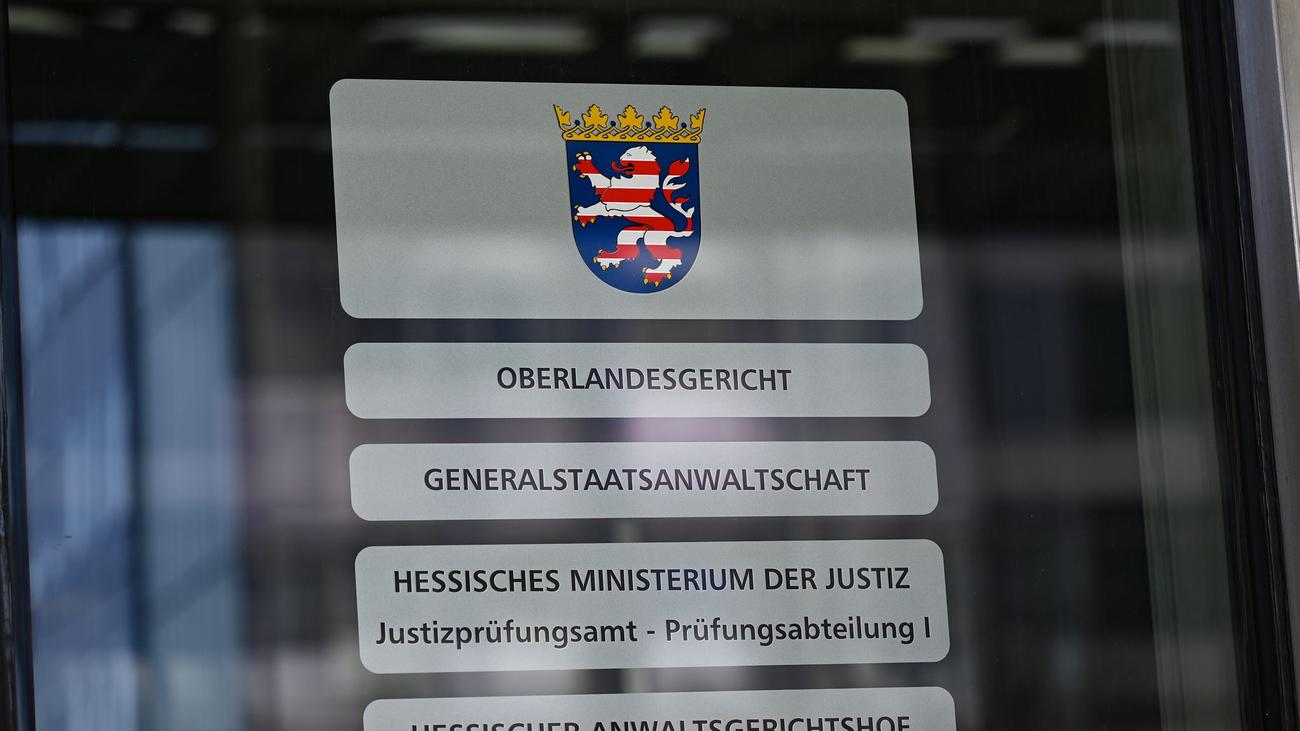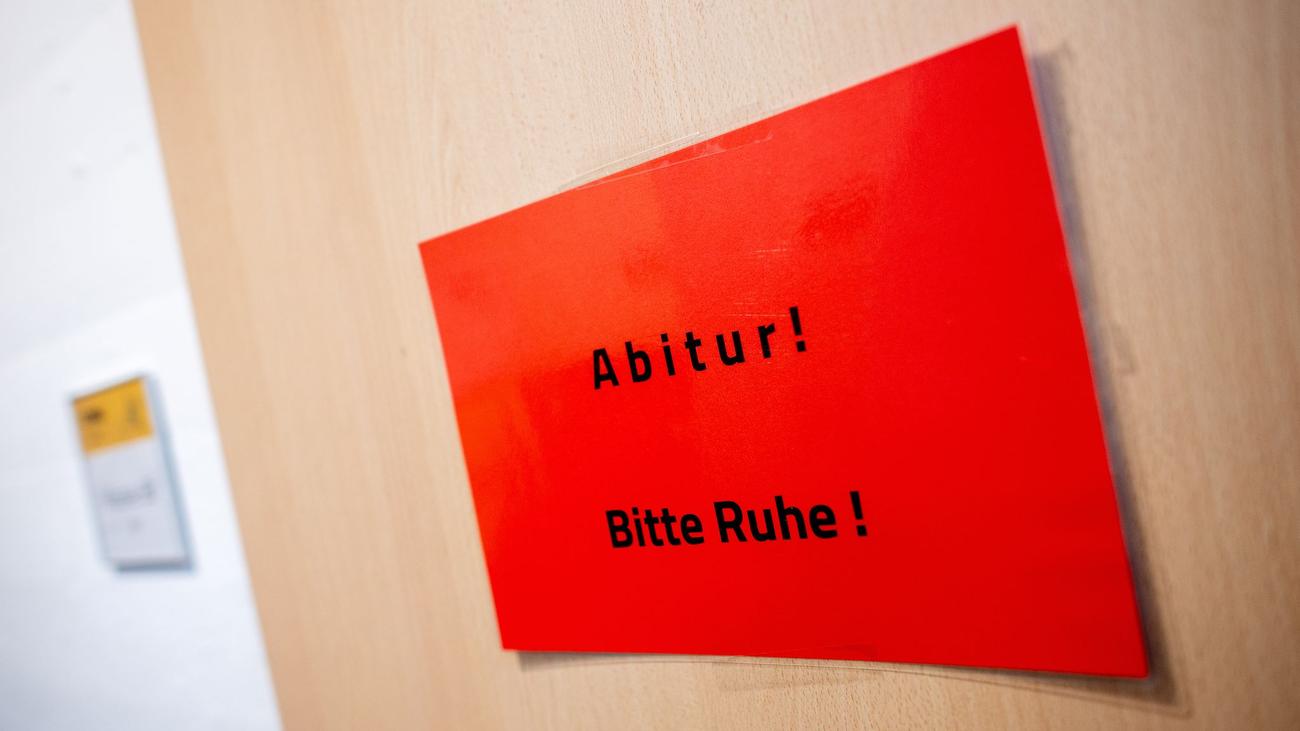Navigation: Vor 25 Jahren gab die US-Regierung GPS frei

Anzeige Bei manchen Entwicklungen werden die Auswirkungen erst im Abstand sichtbar: Als der damalige US-Präsident Bill Clinton am 1. Mai 2000 veranlasste, dass das zivile Signal des US-Satellitennavigationssystem Global Positioning System (GPS) ebenso genau sein soll wie das militärische, stieß er eine Entwicklung an, die die Navigation grundsätzlich revolutioniert hat. 25 Jahre später hat sich die Art und Weise, wie wir den Weg zu einem Ziel finden, dadurch grundlegend geändert. Neue Anwendungen, von Geocaching bis Geotagging, sind entstanden. "Ich freue mich, heute ankündigen zu können, dass die Vereinigten Staaten die absichtliche Verschlechterung der für die Öffentlichkeit zugänglichen Signale des Global Positioning System (GPS) ab heute um Mitternacht einstellen werden", erklärte Clinton. "Das bedeutet, dass zivile GPS-Nutzer ihren Standort bis zu zehnmal genauer bestimmen können als bisher." Bis dahin hatte das US-Militär als Betreiber des Systems das Signal für zivile Nutzer absichtlich gestört, sodass eine Positionsbestimmung nur auf etwa 100 Meter genau war. Das sollte verhindern, dass ein Gegner das System für seine Zwecke nutzt, für die Navigation oder um Lenkwaffen ins Ziel zu bringen. GPS ist alltäglich geworden Seit der Abschaffung dieser "Selective Availability" – etwa: selektive Verfügbarkeit –, hat das zivile GPS-Signal eine Genauigkeit von 10 bis 15 Metern und ist aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Praktisch jedes Smartphone auf dem Markt ist gleichzeitig ein Empfänger für mehrere globale Satellitennavigationssysteme (Global Navigation Satellite System, GNSS) – denn GPS hat längst Gesellschaft bekommen. Dicke Straßenatlanten, Landkarten oder Stadtpläne gehören längst der Vergangenheit an. Wer heute eine Reise antritt, sich im Gelände oder einer unbekannten Stadt zurechtfinden muss, gibt das Ziel in ein Navigationssystem oder in eine Smartphone-App ein und lässt sich elektronisch zum Ziel leiten. Anzeige Das jeweilige System kennt den schnellsten, kürzesten, attraktivsten oder energieeffizientesten Weg dorthin. Das Blättern im Atlas oder das Hantieren mit Wanderkarten oder den unhandlichen Falkplänen erübrigt sich. Ein Gerät braucht Kontakt zu vier Satelliten Dafür muss das Gerät ein Signal von mindestens vier der derzeit rund 30 Satelliten empfangen. Das Signal enthält die Angabe der Position des Satelliten sowie die Absendezeit - jeder GPS-Satellit verfügt über eine sehr genau Uhr. Aus den Signallaufzeiten errechnet das Empfangsgerät, also beispielsweise das Smartphone, seine Position. Staus, Baustellen und andere Verkehrsbehinderungen werden, wenn möglich, umgangen, und das auch noch verlässlicher und aktueller als mit den Verkehrsnachrichten, die im Halbstunden-Rhythmus im Radio gesendet werden – GPS sei Dank: Die großen Kartenanbieter wie Google erhalten von ihren Kunden Bewegungsdaten. Sendet eine große Anzahl von Geräten auf einer Straße kaum veränderte Positionen, herrscht dort Stau. Die Straße wird auf der digitalen Karte rot eingefärbt. Unternehmen statten ihre Fahrzeugflotten mit GPS-Trackern aus. So können sie stets sehen, wo das jeweilige Gefährt gerade ist – und es etwa wiederfinden, wenn es entwendet wurde. Vor allem lässt sich darüber auch voraussagen, wann etwa ein Transport oder ein Fernzug seinen Bestimmungsort erreichen wird. Auf dem Wasser vereinfacht das GPS den Seglern und Motorbootfahrern die Navigation erheblich. Zwar müssen, zumindest auf deutschen Gewässern, immer noch Papierseekarten an Bord sein. Doch der Standard-Freizeitsegler bestimmt seine Position nicht mehr anhand von Leuchtfeuern, Landmarken oder der Höhe der Sterne, sondern elektronisch. Inzwischen dürften auch Tablet und Smartphone die oft sehr teuren Navigationsgeräte, Kartenplotter genannt, mehr und mehr verdrängen.